

Volume 17, No. 1, Art. 15 – Januar 2016
Zwischen "Arzt spielen", "Work-Life-Balance" und "Highend-Medizin". Wird "hegemoniale Männlichkeit" in der Medizin herausgefordert?
Katharina Rothe, Johannes Deutschbein, Carsten Wonneberger & Dorothee Alfermann
Zusammenfassung: Wir diskutieren die Frage, ob eine sogenannte "Feminisierung" bestehende "maskuline" Machtstrukturen in der Medizin herausfordert. Die Rede von der "Feminisierung der Medizin" setzt sowohl die "Maskulinität" voraus als auch deren Veränderung durch die Erhöhung des Frauenanteils. Wir stellen die Kontrastanalyse zweier Gruppendiskussionen aus der Längsschnittstudie Karriereverläufe und Karrierebrüche bei Ärztinnen und Ärzten während der fachärztlichen Weiterbildung (KarMed) vor; eine Diskussion mit angehenden Ärztinnen und eine mit angehenden Ärzten. Als manifestes Thema wurde Geschlechtlichkeit in beiden Diskussionen im diskursiven Kontext der sogenannten "Feminisierung" eingeführt – bezeichnenderweise im Kontrast zur gleichsam mythisch aufgeladenen Maskulinität der Chirurgie. Das Material unserer Gruppendiskussionen verweist auf eine nach wie vor maskuline Norm im Selbstverständnis der angehenden Ärztinnen und Ärzte. Die Männerrunde konstituierte sich als Gruppe der Ärzteschaft bei allen Differenzen wie selbstverständlich als männliche Norm. Die Frauengruppe konstituierte sich über eine geteilte Identifikation als "Frauen in der Medizin". Das Material wurde mit Methoden der psychoanalytischen Sozialforschung interpretiert und wird in diesem Beitrag im Hinblick auf die Begriffe der Feminisierung und der hegemonialen Männlichkeit diskutiert.
Keywords: Medizin, Geschlecht; Gender Studies; Mutterschaft; Feminisierung; hegemoniale Männlichkeit; Gruppendiskussionen; psychoanalytische Sozialforschung
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Methoden
3. Die Frauengruppe
4. Die Männergruppe
5. Diskussionsverläufe und Interpretation
5.1 Ärztinnen als "Frauen in der Medizin"
5.2 Teilzeitarbeit: ein Problem der Frauen
5.3 Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben als primäre Frage der beruflichen Zukunftsplanung einer Ärztin
5.4 Austausch über die männlichen Kollegen
5.5 Widersprüche zur "Geschlechterproblematik"
6. Kontrastanalyse
6.1 Assoziation von "Frauen und Familie" versus egalitäre Modelle
6.2 "Glamour" versus "Scheißjob" oder gar Tod: bedrohte "Männlichkeit"?
6.3 Status, Anerkennung, Geschlecht: eine autoritär-paternalistische Orientierung
7. Diskussion
Seit einigen Jahren wird von der sogenannten "Feminisierung" der Medizin gesprochen (BUDDEBERG-FISCHER, STAMM, BUDDEBERG & KLAGHOFER 2008, S.124), wenn auf die Zunahme des Anteils von Ärztinnen rekurriert wird.1) Der Begriff wird vor allem in amerikanischer Literatur kritisch diskutiert (BOULIS & JACOBS 2008, S.3; KILMINSTER, DOWNES, GOUGH, MURDOCH-EATON & ROBERTS 2007, S.40; REICHENBACH & BROWN 2004, S.793), denn er wird nicht nur in deskriptiver, sondern auch in problematisierender Weise verwendet. So wird u.a. ein damit einhergehender Statusverlust des ärztlichen Berufs diskutiert (BOULIS & JACOBS 2008, S.6), wobei die Frage gestellt wird, ob der Statusverlust Folge oder Grund für die Zunahme von Ärztinnen sei. Auch wird untersucht, ob und wie sich die Medizin in ihrer Praxis ändere und "sozialer", "weicher", "menschlicher", "personenzentrierter" werde – mit anderen Worten, es werden den Ärztinnen traditionell weibliche Stereotype zugeschrieben. Kritisch diskutiert wird dies bspw. bei BOULIS und JACOBS (2008), KILMINSTER et al. (2007) sowie PRINGLE (1998). [1]
Die moderne Medizin, wie sie sich in Europa seit dem 17.-18. Jahrhundert etablierte (FOUCAULT 1988 [1973]), wird in mehrfacher Hinsicht als traditionell "männliches" soziales Feld beschrieben. Zunächst hatten Frauen keinen Zugang zum Medizinstudium, in Deutschland ist dies beispielsweise erst seit etwa 100 Jahren möglich (BRINKSCHULTE 2006, S.13). Darüber hinaus aber lässt sich von einem männlich dominierten Feld in dem Sinne sprechen, dass das Ärztliche als Norm maskulin konnotiert bleibt, die Pflege dagegen feminin (vgl. SANDER 2009). Unseres Erachtens lässt sich der von CONNELL (1987) geprägte Begriff der "hegemonialen Männlichkeit" heranziehen, um das Idealbild des erfolgreichen männlichen Arztes zu beschreiben. Es zeigt sich am Ausgeprägtesten verkörpert im (Ideal-) Bild des Chirurgen, des "iron surgeon" (CASSELL 1998, S.100), einem männlich konnotierten Heldentypus, der hart gegenüber sich selbst und seinen Bedürfnissen, der Sache wegen, gegen alle Widrigkeiten tapfer weiter streitet. CASSELL (1997, S.47) erfasst diesen Typus mit dem BOURDIEUschen Begriff des Habitus. Dieser hat den Vorteil, dass er als "Leib gewordene Geschichte" (BOURDIEU 2009 [1976], S.200) die Verkörperlichung von gesellschaftlicher Praxis im Blick hat und damit auch unbewusste Prozesse greifen kann, die sich teilweise mit psychoanalytischer Terminologie in den Mechanismus der Identifizierung übersetzen lassen. Nach BOURDIEU bildet sich ein Habitus heraus in Feldern der sozialen Praxis, in denen jeweils bestimmte Spielregeln herrschen. Als ein solches Feld betrachten wir hier die moderne Medizin. [2]
CONNELLs Konzept der hegemonialen Männlichkeit dagegen kann fassen, dass es verschiedene Männlichkeiten gibt, die je unterschiedlich positioniert sind in gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Als relationaler Begriff verweist die hegemoniale Männlichkeit darauf, dass diese immer in Relation zu anderen Männlichkeiten sowie zu Frauen konstruiert wird. Inzwischen ist zwar die These verbreitet und schlüssig, dass sich verschiedene hegemoniale Männlichkeiten herausbilden, allerdings seien sie nur dann hegemonial, wenn sie milieuübergreifend Wirksamkeit entfalten (1987, S.169-170). [3]
Wie BRANDES (2004) und MEUSER (2009) verknüpfen wir die Konzepte CONNELLs und BOURDIEUs miteinander, auch wenn diese beiden Autoren selbst dies nicht getan haben (MEUSER 2009, S.161). Im vorliegenden Aufsatz verwenden wir den Begriff hegemonialer Männlichkeit heuristisch als Instrumentarium, um den Habitus des ärztlichen Idealtypus zu beschreiben. Den Diskurs über die sogenannte Feminisierung der Medizin kritisch aufgreifend möchten wir die Frage stellen, ob das "maskuline Feld" der Medizin sich im Selbstverständnis der Ärztinnen und Ärzte mit der Frauenzunahme verändert. Wird gar das Ideal "hegemonialer Männlichkeit" herausgefordert? Wir tun dies, indem wir die komparative Kontrastanalyse zweier Diskussionsgruppen gegenüberstellen. [4]
Die hier präsentierten Analysen fußen auf ausgewählten Ergebnissen der Längsschnittstudie "KarMed"2). Dort führten wir qualitative Interviews und Gruppendiskussionen durch, entlang derer die Begründungszusammenhänge, Verläufe und Entscheidungen beruflicher Sozialisation analysierbar wurden. In diesem Beitrag wird die vergleichende Analyse zweier Gruppendiskussionen vorgestellt. [5]
Zunächst werden wir den Aufbau und Verlauf der Gesamtstudie skizzieren, bevor wir uns dem Erhebungsverfahren der themenzentrierten Gruppendiskussion und ihrer Auswertung zuwenden (Abschnitt 2). In den Abschnitten 3 und 4 werden die Teilnehmenden der Gruppen vorgestellt und die thematischen Verläufe der Diskussionen zusammengefasst. Im Hauptteil (Abschnitte 5 und 6) dokumentieren wir die Ergebnisse der Analyse der Diskussion mit angehenden Ärztinnen, um daraufhin vergleichend der Analyse der Diskussion mit angehenden Ärzten gegenüberzustellen. Zuletzt (Abschnitt 7) werden die Resultate im Hinblick auf die Fragestellung abschließend diskutiert. [6]
Die KarMed-Studie war eine Langzeitstudie, in der bundesweit die berufliche Entwicklung von Ärztinnen und Ärzten über den Verlauf der fachärztlichen Weiterbildung anhand von Fragebögen erhoben wurde und Gruppendiskussionen mit Teilgruppen aus dem quantitativen Sample geführt wurden. Darüber hinaus wurden Interviews mit Ärztinnen und ihrem Beziehungspartner oder ihrer Partnerin geführt, um das Zusammenspiel bzw. Konfligieren von ärztlichem Berufs- und Privatleben zu analysieren. Die Studie verlief in insgesamt vier Erhebungswellen. [7]
In der ersten Erhebungswelle, auf die sich dieser Artikel bezieht, nahmen an sechs (geschlechtergetrennten) Gruppendiskussionen an vier Universitätskliniken insgesamt 17 Frauen (W) und 9 Männer (M) teil, die gerade ihr Praktisches Jahr (PJ)3) beendeten. In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf die kontrastierende Analyse zweier Gruppendiskussionen. Die angehenden Ärztinnen und Ärzte wurden später, soweit möglich, über den Verlauf ihrer fachärztlichen Weiterbildung wiederholt interviewt. [8]
Der methodische Hintergrund der qualitativen Teilstudie liegt mit der Themenzentrierung – themenzentrierte Interviews und Gruppendiskussionen (LEITHÄUSER & VOLMERG 1988; LÖCHEL 1997) – in der psychoanalytisch orientierten Sozialforschung. Themenzentrierte Erhebungen sind offene Verfahren zu einem vorgegebenen Thema. Ein "Leitfaden" dient zur thematischen Orientierung – doch steht im Mittelpunkt, dass die Teilnehmenden selbst entfalten können, was ihnen jeweils wichtig ist. Aufgabe der Moderierenden der Diskussionen ist vornehmlich, "solche subjektiven Thematisierungen" (LÖCHEL 1997, S.58) zu fördern. Ergänzend rekurrieren wir auf das Gruppendiskussionsverfahren, wie es in der rekonstruktiven Sozialforschung vor allem von BOHNSACK (1997) geprägt wurde. Zentral für diesen Ansatz sind "kollektive Orientierungsmuster" und der Milieubegriff, unter anderem im Hinblick auf Geschlechter-, Generationen-, Bildungs- und sozialräumliche Milieus. Vor diesem Hintergrund werden auch individuelle biografische Erfahrungen als durch milieuspezifische Kontexte geprägt verstanden. Als eine Schnittstelle solcher "Milieus" verstehen wir in unserer Studie das Medizinstudium und die berufliche Sozialisation an den Universitätskliniken. Diese Ergänzung der psychoanalytischen Sozialforschung erwies sich als fruchtbar, da die soziologischen Begriffe der "kollektiven Orientierungsmuster" und des Milieus die Dimension des Kollektiven der Gruppe der angehenden Ärzte und Ärztinnen zu fassen vermögen. [9]
Die Gruppendiskussionen der ersten Erhebungswelle wurden folgendermaßen gestaltet. Zu Beginn der Diskussionen führte die Moderation die Teilnehmenden in den Aufbau und Verlauf der Langzeitstudie KarMed ein und forderte die Teilnehmenden zur regen Diskussion untereinander auf, während sich die Moderation weitgehend zurückhalten würde. Die Teilnehmenden wurden eingeladen, über ihre bisherigen Erfahrungen in der Medizin sowie über berufliche Wünsche, Ziele und Erwartungen miteinander ins Gespräch zu kommen. Als weiteres Thema wurde bereits zu Beginn die Verknüpfung des Beruflichen mit dem Privatleben eingeführt. Damit wurden die Themen spezifisch genug gestellt und auf die Fragestellung der Studie bezogen, dabei aber zugleich so offen gehalten, dass die Teilnehmenden ins Gespräch darüber kommen konnten, was ihnen wichtig war. In Anlehnung an die freie Assoziation4) der Psychoanalyse ließen wir als Moderierende uns auf die thematischen Beiträge und Diskussionsverläufe ein, anstatt diese in eine bestimmte Richtung zu lenken. [10]
Die psychoanalytisch orientierte Auswertung qualitativen Materials nimmt die Perspektive ein, dass die Subjektivität der Forschenden nicht aus dem Forschungsprozess herauszuhalten ist. Anstatt sie auszublenden, wird sie mit erhoben und in die Analyse einbezogen: Neben der manifesten Ebene zielt eine solche Interpretation letztlich auf die Psychodynamik, "das Verhältnis von Thematisierung und Abwehr von Konflikten" (LÖCHEL 1997, S.64), also auf latente Inhalte, die den Teilnehmenden (inklusive der Forschenden) unbewusst sind. Im Gegensatz zur klinischen Psychoanalyse geht es aber nicht um individuelle Bedeutungen dieser Konflikte, sondern um das Allgemeine im Besonderen, um Konflikt- und Abwehrformen, wie sie sich durch alle Beteiligten in einer aktuellen Erhebungssituation im Hinblick auf den Gegenstand (re)inszenieren und dabei immer auch eine überindividuelle Bedeutsamkeit besitzen. [11]
Einen Zugang zu dieser Ebene stellt das "szenische Verstehen" (LORENZER 1986, 1995 [1973]) als eine Form der Gruppenauswertung dar. Die transkribierten Interviewtexte enthalten demnach immer auch Szenen und Beziehungsangebote, die Figuren des Bedeutungsüberschusses entstehen lassen und die während des gemeinsamen Lesens und Interpretierens hervortreten (LÖCHEL, 1997, S.49). Es ist dieser Bedeutungsüberschuss, dem sich das szenische Verstehen zu nähern sucht, indem sich die Interpretation an durch den Text hervorgerufenen Irritationen, Brüchen und Widersprüchen im Text orientiert. In einer Gruppe weisen die (Re)Inszenierungen insbesondere über das einzelne Individuum hinaus (MORGENROTH 2001, S.215), besitzen eine überindividuelle, kollektive Bedeutung. In einer themenzentrierten Gruppendiskussion (LEITHÄUSER & VOLMERG 1988) werden solche (Re)Inszenierungen gefördert. Siehe zur ausführlichen Darstellung der Methode DECKER, ROTHE, WEISSMANN, GEISSLER und BRÄHLER (2008), LEITHÄUSER und VOLMERG (1988), LÖCHEL (1997), LORENZER (1986); ROTHE (2009) und SALLING OLESEN (2012). [12]
Die themenzentrierten Gruppendiskussionen der KarMed-Studie haben wir folgendermaßen ausgewertet: Die Audiodateien wurden vollständig transkribiert. Darüber hinaus haben wir als Moderierende direkt im Anschluss an eine Erhebung ausführliche Gedächtnisprotokolle bzw. "Affektprotokolle" (ROTHE 2009) erstellt, in denen wir neben Beobachtungen vor, während und nach der Erhebung unsere affektiven Eindrücke und Reaktionen beschrieben. Bei der Interpretation wurden diese Affektprotokolle systematisch mit in die Analyse einbezogen, insbesondere um Aufschluss über die Psychodynamik zu erhalten. [13]
Die Analyse gliedert sich in eine horizontale Ebene und eine vertikale Ebene, wobei die vertikale Ebene eine ausführliche Analyse z.B. eines gesamten Textabschnittes oder einer Gruppendiskussion beinhaltet (LEITHÄUSER & VOLMERG 1988, S. 238ff). Die horizontale Ebene bezieht sich auf die Breitendimension. Angewandt auf eine themenzentrierte Gruppendiskussion bedeutet dies das Herauskristallisieren von "Bedeutungsfiguren" (ROTHE 2009) über den gesamten Text hinweg, angewandt auf eine Erhebungswelle oder die gesamte Untersuchung über die verschiedenen Erhebungen hinweg. [14]
Der erste Schritt der Auswertung war die Sequenzierung bzw. thematische Gliederung der Transkripte (LEITHÄUSER & VOLMERG 1988, S. 238ff.). Die damit erreichte Zusammenfassung der Diskussionen richtete sich auf die vertikale Ebene; darüber hinaus wurden damit Themen extrahiert, die in der folgenden komparativen Analyse (LEITHÄUSER & VOLMERG 1988; ROTHE 2009) die Basis für die horizontale Auswertung darstellten. [15]
Dem systematischen Vergleich und der minimalen und maximalen Kontrastierung von Einzelfällen kommt eine zentrale Funktion im Interpretationsprozess zu (LEITHÄUSER & VOLMERG 1988, S.241f.). In diesem Beitrag fokussieren wir auf den kontrastierenden Vergleich zweier Diskussionen, W1 und M1, da diese sowohl gruppendynamisch wie auch thematisch einen maximalen Kontrast aufweisen, anhand dessen Licht auf unsere Frage nach bestehenden Machtstrukturen im subjektiven Erleben junger Ärztinnen und Ärzte geworfen werden kann. Wir analysieren diese Diskussionen im Hinblick darauf, wie Geschlechtlichkeit explizit wie auch implizit eine Rolle spielt: Welche Vorstellungen und Bilder von "Weiblichkeit" und "Männlichkeit" werden ent- oder auch verworfen? Was bedeutet dies weiter für die geschlechtlichen und beruflichen Identifikationen5) und schließlich für die sogenannte "Feminisierung" der Medizin? [16]
Im Folgenden werden die beiden Gruppen mit ihren Teilnehmenden zunächst vorgestellt und thematisch zusammengefasst. Im anschließenden Hauptteil dokumentieren wir die Ergebnisse der Kontrastanalyse, wobei die Abschnitte jeweils mit den Themen der analysierten Sequenzen überschrieben sind. [17]
Die Diskussion W1 wurde von einer Moderatorin geleitet. Es nahmen sechs angehende Ärztinnen im Alter von 26-39 Jahren teil: Frau Hausmann6), Frau Lubisch, Frau Mersel, Frau Lange, Frau Schmidt und Frau Kaya. Grundlage der Diskussion war ein von allen Teilnehmerinnen geteiltes Thema, das von Beginn an die Diskussion durchzog: die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Mutterschaft. Vor diesem Hintergrund entstand eine solidarische Grundhaltung, die auch über vereinzelte Widersprüche hinweg fortdauerte und die Atmosphäre der Diskussion prägte. In den Hintergrund trat sie nur, wenn die Erfahrungen im PJ ausgetauscht und besprochen wurden. Diese spielten aber eine weit geringere Rolle als in anderen Diskussionen und wurden nacheinander abgehandelt. Zum Leitmotiv wurde die Frage der Vereinbarkeit, wenn über die geplante fachärztliche Weiterbildung, präferierte Arbeitsbereiche und Arbeitsbedingungen gesprochen wurde. [18]
Die Diskussion war selbstläufig, d.h. Nachfragen der Moderation hatten nur einen bedingten Gestaltungseffekt, was ein Indiz dafür ist, dass die verhandelten Themen "selbstverständlich" waren. Die Teilnehmerinnen betonten Gemeinsamkeiten. Widersprüche wurden ausformuliert, tendenziell aber relativiert. Abgesehen von einigen kleineren Ungleichgewichten waren alle an der Diskussion beteiligt und nahmen lebhaft Anteil. Gesagtes wurde fast immer von den anderen Teilnehmerinnen aufgegriffen. [19]
Zum Zeitpunkt der Befragung plante Frau Hausmann die fachärztliche Weiterbildung in der Anästhesie an einem Universitätsklinikum, an das sie ihrem Freund folgen wollte. Frau Lubisch antizipierte Verzögerungen in ihrer Ausbildung aufgrund ihrer Mutterschaft und hatte noch nicht entschieden, welche Fachrichtung sie anstrebte. Wie Frau Mersel wollte sie sich mittelfristig niederlassen. Frau Lange wollte zunächst ein Jahr an einer Schweizer Klinik arbeiten, um danach die Weiterbildung in der Psychiatrie aufzunehmen. Sie war die einzige Teilnehmerin mit explizit monetären Motiven. Auch Frau Schmidt wollte sich niederlassen nach einer Weiterbildung in der Allgemeinmedizin. Frau Kaya konnte sich eine Tätigkeit in einem peripheren Krankenhaus7) im Bereich Psychosomatik oder Psychiatrie vorstellen. Keine Teilnehmerin brachte manifest eine Karriereorientierung8) zum Ausdruck; eher wurde eine "klassische" Karriere (an einer Universitätsklinik9)) entwertet (Pos. 54, Pos. 471). Frau Hausmann äußerte als einzige das Ziel der Unikliniklaufbahn, aber ein nur zaghaftes Interesse an Forschung. [20]
An der Diskussion M1 nahmen sechs angehende Ärzte im Alter zwischen 24 und 31 Jahren teil; sie wurde von zwei Moderatoren geleitet. Es diskutierten Herr Kohlhaas, Herr Sänger, Herr Scholler, Herr Lorenz, Herr Graf und Herr Ammer. Während Herr Kohlhaas und Herr Sänger sich insgesamt eher zurückhielten und wenig sprachen, beteiligten sich Herr Scholler und Herr Lorenz deutlich stärker. Herr Graf und Herr Ammer diskutierten dagegen sowohl quantitativ als auch qualitativ (in Lautstärke, Emotionalität, Vehemenz) besonders dominant. [21]
Hauptthemen waren Erfahrungen im PJ, Status und Hierarchien in Kliniken, Ausbildungsbedingungen und Belastungen an der Uniklinik im Kontrast zu peripheren Häusern, die Bezahlung, die Situation der Assistenzärzt_innen in der Ausbildung, die eigenen Zukunfts- und Karrierepläne sowie (Personal-) Politik. Nur zu einem geringen Teil wurden Fragen nach der Verknüpfung des ärztlichen Berufs mit dem Privatleben sowie der Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf diskutiert. [22]
Grundmerkmal der Diskussion war eine stark von Konkurrenz und Aggression geprägte Atmosphäre, die aber vorwiegend von zwei Personen hergestellt wurde. Von Beginn an war die Stimmung von Misstrauen geprägt, auch gegenüber den Moderatoren. So verwies ein Moderator bei der Erläuterung der Studie scherzhaft darauf, dass sich das Qualitative "nicht auf die Qualität der Untersuchung sondern ☺auf die Methode bezieht☺" (Pos. 2), worauf Herr Kohlhaas entgegnete: "ganz blöd sind wir ja nicht ☺(3)☺" (Pos. 4).10) Hiermit waren von Beginn an die Themen Status bzw. Kompetenz und deren Infragestellung angeschnitten. Im Verlauf der Diskussion stellte sich zunehmend eine offene Konflikt- und Konkurrenzsituation zwischen den beiden Teilnehmern Graf und Ammer her. [23]
Die Mehrzahl der Teilnehmer wies keine Karriereorientierung im engeren Sinne auf, d.h. die Orientierung an einem Aufstieg an einem (Universitäts-)Klinikum. Zwei Teilnehmer (Herr Lorenz und Herr Scholler) waren ausgesprochen freizeitorientiert – "work-life-balance mehr auf life gedreht" (Pos. 54). Dies lasse sich längerfristig zum Beispiel als "Amtsarzt" (a.a.O.) erreichen. [24]
Herr Kohlhaas und Herr Sänger formulierten beide das Ziel, sich als Hausärzte auf dem Lande niederzulassen. Dagegen wurde das Klinikmilieu von Herrn Sänger als stark von Konkurrenz geprägt und als belastend geschildert. Herr Kohlhaas stellte sein Ziel explizit in Kontrast zu seinem stärkeren inhaltlichen Interesse an der Chirurgie. Doch könne er mit der eigenen Praxis "für [s]ein Leben am meisten erreichen" (Pos. 50). [25]
Die dominierende Tendenz der Diskussion, wenngleich lediglich getragen von Herrn Graf und Herrn Ammer, war jedoch geprägt von einer ausgesprochenen Karriereorientierung. Herr Ammer wies eine monetäre Karriereorientierung auf. Neben einer klassischen ärztlichen Tätigkeit könne er sich auch eine Karriere als Manager eines Versorgungszentrums oder in der Pharmaindustrie vorstellen (Pos. 55). Herr Graf verknüpfte mit dem Aufstieg an einer Uniklinik "Glamour" und Anerkennung. Zugleich war er (als einziger Teilnehmer) Ehemann und Vater zweier Kinder, deren Ansprüche er als widersprüchlich zu seinen Karriereambitionen beschrieb. [26]
5. Diskussionsverläufe und Interpretation
In den folgenden Abschnitten werden wir die Ergebnisse der Kontrastanalyse vorstellen. Dabei werden wir zunächst den Verlauf der Diskussion mit Ärztinnen ausführlich beschreiben, da diese Diskussion zeitlich vor der Diskussion mit Ärzten stattfand. Wir werden sowohl auf Themen wie auch die Gruppendynamik eingehen und uns von der manifesten zur latenten Ebene in der Interpretation vortasten. Daraufhin werden wir kontrastierend die Interpretation der Männerdiskussion darstellen. Die komparative Kontrastanalyse fußt auf dem Vergleich im Hinblick auf Themen wie auch die Gruppendynamik. [27]
5.1 Ärztinnen als "Frauen in der Medizin"
Frau Hausmann stellt sich bereits zu Beginn als Ärztin und Mutter vor. Bereits mit 15 Jahren habe sie Ärztin werden wollen und sei zufrieden mit der Berufswahl.
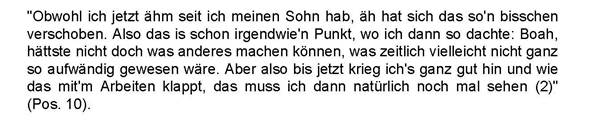
Mutterschaft wird damit als ein Thema eingeführt, das grundsätzlich die zeitliche Vereinbarkeit mit dem ärztlichen Beruf infrage
stellen könnte. In der dritten Sequenz greift Frau Lubisch das Thema wieder auf, indem sie den Zeitpunkt ihres Examens ein
halbes Jahr über die Regelstudienzeit hinaus mit der Familiengründung in Zusammenhang bringt (Pos. 36). Im selben Atemzug
bringt sie das Modell des "Familienernährers" ins Spiel, das sie in der Paarbeziehung praktizierten: "Also ähm' ja mein Mann
arbeitet und holt das Geld ran und☺" (Pos. 39). [28]
Im Folgenden wird die Ausrichtung auf eine Karriere im engeren Sinne im Gegensatz zur Mutterschaft diskutiert, ausgelöst durch Frau Schmidt, die ihre Erfahrungen in einem Team einer Universitätsklinik als positiv schildert, aber zugleich vom Ziel, an der Uniklinik zu bleiben, abrückt (Pos. 54).
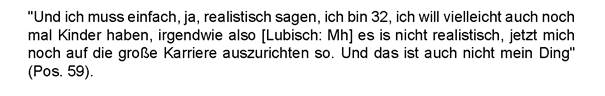
Damit wird der Gegensatz von "klassischer" Karriere und eigenen Kindern für "Frauen in der Medizin" ausgesprochen und als
konsensueller Ausgangspunkt der folgenden Diskussion etabliert: Wie im Folgenden ausführlich am Material der Diskussion gezeigt
wird, basiert das identifikatorische Grundmoment der Gruppensituation auf einer mehr oder weniger bewusst geteilten Abweichung
von der Norm "der Ärzte". Die angehenden Ärztinnen werden zu "Frauen in der Medizin", weil sie das "Merkmal" teilen, Mutter
sein zu können. Dass eine Teilnehmerin, Frau Kaya, keine Kinder haben möchte, wird von keiner anderen Teilnehmerin aufgegriffen.
Die berufliche Identifikation als Ärztin erscheint also von Beginn an bei allen Teilnehmerinnen geschlechtlich konnotiert.
[29]
5.2 Teilzeitarbeit: ein Problem der Frauen
Über die Kontrastierung von Kinderwunsch und Karriereambition an der Universitätsklinik durch Frau Schmidt empört sich Frau Hausmann: "Aber das is total krass, weil ich finde das hört man von so vielen" (Pos. 55). Im selben Atemzug assoziiert sie den Fachbereich Chirurgie und ihre Freude an der Tätigkeit im Operationssaal, den sie in einen Gegensatz zum Frausein setzt: "So im OP stehen und so, mir hat das schon Spaß gemacht … Aber ich würde alleine wegen dieser körperlichen Belastbarkeit und so ähm". [30]
Frau Hausmann bricht diesen Satz ab, doch kommt sie in der Fortsetzung auf die Arbeitsbedingungen zu sprechen, die das Berufsfeld für Frauen – als (potenzielle) Mütter – nicht nur unattraktiv machten, sondern inkompatibel seien:
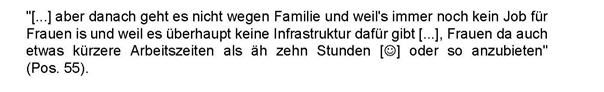
Die körperliche Belastbarkeit steht also im Kontext von Vorstellungen von "Weiblichkeit", die unwidersprochen bleiben, und
erinnert an biologisch basierte Argumentationen, die noch vor wenigen Jahrzehnten gang und gäbe waren, nämlich dass Ärztinnen
u.a. aufgrund physischer und psychischer "Ausstattung" weniger als Chirurginnen geeignet seien. [31]
Diesem Topos wird, ebenso wenig wie der Gleichsetzung von Frauen und Müttern, die für die Familie zuständig seien, von keiner Teilnehmerin widersprochen. Stattdessen wird die Qualität einzelner medizinischer Fächer entlang der Teilzeitmöglichkeiten diskutiert. Dabei wird festgestellt, dass selbst die Inhaberinnen derartiger Stellen "immer die Gearschten" (Pos. 61) seien, weil sie trotzdem länger arbeiten müssten und "auch immer aber eins auf'n Deckel gekriegt" (a.a.O.) hätten. An einer unvermittelten Äußerung Frau Mersels zeigt sich erneut, dass dies selbstverständlich als ein geschlechtsspezifisches Problem betrachtet wird: "Also (.) wir ham doch gesehen wie viel Mädels saßen von uns im Hörsaal und wie viel wie viel Typen waren dadrunter" (Pos. 79). [32]
Die mit dieser Manifestation deutlich werdende Latenz, die besprochenen Probleme unter der Perspektive von "Frauen in der Medizin" zu erörtern, wird die Diskussion bis zu ihrem Ende begleiten: Die angehenden Ärztinnen stellen sich nicht als die Norm in der Profession dar, sondern in erster Linie als Frauen, für die die beruflichen Strukturen nicht förderlich sind. Ebenfalls anscheinend selbstverständlich wird die Frage nach Teilzeitverträgen zu einem "Problem der Frauen". [33]
5.3 Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben als primäre Frage der beruflichen Zukunftsplanung einer Ärztin
Ohne eindeutigen Anknüpfungspunkt, somit die Latenz des Themas verdeutlichend, lenkt Frau Hausmann nach einer Sequenz über PJ-Erfahrungen den Fokus direkt auf die Frage "Kinder planen" (Pos. 272), was auf die Vereinbarkeit von eigenen Kindern und beruflichem Fortkommen zielt. Diese ist implizit mit der Forderung verbunden, dass diese Vereinbarkeit hergestellt werden müsse sowie mit der Frage, wie dies möglich sei. Frau Lubisch, von Frau Hausmann direkt angesprochen und für ihre Leistung bewundert (Pos. 272), formuliert mit ihren persönlichen Erfahrungen die sachliche Grundlage der folgenden Diskussion und manifestiert so ihre Rolle als Expertin. Die eben noch lebhafte Diskussion weicht einem Monolog Frau Lubischs, den alle gespannt verfolgen. Ein Kind zu bekommen sei während des Studiums einfacher, weil "man sich das ja alles immer noch so selber zurechtpfriemeln" (Pos. 275) könne. Bei einer Kliniktätigkeit aber drohe, "wirklich nie'n Facharzt zu kriegen" (Pos. 275), oder die Ausbildungszeit verdopple sich bei einer halben Stelle von fünf auf zehn Jahre. Der verborgene Tenor ist aber, dass das Vereinbarkeitsproblem eines der Frau sei, da der Kindsvater in der Erzählung völlig verschwindet. Wenn auch ohne manifesten Widerspruch, interveniert Frau Lange, indem sie direkt auf ihren Freund zu sprechen kommt. Sie ist die einzige Teilnehmerin, die konkrete Forderungen und Erwartungen an den eigenen Partner als zukünftigen Vater äußert. Um mit ihm zusammenzuleben, müsse sie ihm an bestimmte Orte folgen, da er sich mit bereits begonnener (Forschungs-) Karriere auf Professuren bewerbe. Dies kollidiert aber mit ihrem Selbst(ideal)bild einer Frau mit Karriereansprüchen und Gestaltungsmacht über ihre persönlichen Lebensumstände, welche sie demonstrativ in der Weigerung ausdrückt, ihrem Freund in eine Stadt wie "Ulm" zu folgen (Pos. 284). Eine Familie sei erst dann gründbar, wenn er sich "ausgeforscht" habe und in ihre Wunschstadt Berlin zurückkehre, denn sie wolle einen aktiven und präsenten Vater (Pos. 288). Bei Frau Lubisch hingegen bleibt der Vater abstrakt und verschwindet in der Figur des "Geldverdieners".11) Die Selbstverständlichkeit, die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als ausschließliches Problem der Mutter zu diskutieren, wird so unterstrichen. Kurz darauf spricht Frau Hausmann potenzielle Väter erneut abstrakt an: "Wobei ich das ganz toll finde, ich habe jetzt in mehreren Fällen, mehrere Männer ähm die auch dieses Elterngeld" beantragen (Pos. 347). [34]
Dieser Einwurf provoziert eine gruppendynamisch bedeutsame Situation. Die in Frau Hausmanns Äußerung enthaltene und von allen geteilte Forderung nach mehr aktiver Beteiligung der Väter an der Kindererziehung beinhaltet zugleich einen unausgesprochenen Widerspruch gegen das Beziehungs- und Erziehungsmodell von Frau Lubisch. Dieser wird von ihr auch aufgegriffen, indem sie rechtfertigt, dass ihr Mann das Geld verdiene und sie somit in ihrer Beziehung eine klassische Rollenaufteilung praktizierten. Es kommt ein Widerspruch zwischen ihrem eigenem Anspruch und der Realität ihrer Beziehung zum Ausdruck, da sie die mit dem Elterngeld für beide Elternteile verbundene Möglichkeit lobt, dass die Frau gleich weiterarbeiten könne und der Mann zu Hause bleibe. Die vorhergehende Begründung, dass ihr Mann arbeite, da er sonst in der "Wirtschaft" einen Karriereknick erleiden würde, während dies aber bei Ärzten kein Problem sei, wird somit nachträglich als rationalisierende Rechtfertigung der persönlichen Lebenssituation verstehbar. Es zeigt sich ein Grundmotiv: die Divergenz vom Selbstbild der jungen Ärztinnen, die sich als selbstständig und selbstbestimmt begreifen, und ihrer Rolle, die sie durch die Dynamik der Paarkonstellation erlangen. Die aufwendige Rationalisierung wird als psychischer Kompensationsmechanismus nötig, da der Konflikt weder innerhalb des Selbstbildes noch in der Beziehung austragbar wäre, ohne die Paarbeziehung oder das Selbstbild in ihrer Grundsubstanz zu gefährden. [35]
Die grundsätzlich solidarische Atmosphäre der Diskussion sowie die geteilte Identifikation als "Frauen in der Medizin" sind unseres Erachtens für die unmittelbar anschließende 15-sekündige Pause verantwortlich. In Einvernehmlichkeit wird der Widerspruch beschwiegen, der kaum offensichtlicher als in den zwei unmittelbar aufeinander folgenden Äußerungen Frau Lubischs auftreten konnte. Es vermittelt sich der Eindruck eines Stillhalteabkommens zwischen den Teilnehmerinnen, dessen Grund in der reziproken Geltung liegt. Das gemeinsame Interesse ergibt sich durch das Wissen, als "Frau in der Medizin" allzu schnell in eine ähnliche Situation geraten zu können. Auf den Punkt gebracht eskaliert an dieser Stelle die Bedrohung des Selbstbildes als autonome Ärztin durch das vermeintlich Unabwendbare des Mutterdaseins. Dass es sich dabei nicht um ein individuelles Problem von Frau Lubisch, sondern einen allgemeinen Widerspruch handelt, mit dem sich die Ärztinnen konfrontiert sehen, wird durch das kollektive Schweigen nahegelegt.12) [36]
5.4 Austausch über die männlichen Kollegen
Die bis dato latent geteilte Identifikation als "Frauen in der Medizin" wird manifest, als sich im Anschluss an die Diskussion der persönlichen Karriereambitionen eine in Bezug auf Geschlechterstereotype interessante und dynamische Diskussion über "Männer in der Medizin" entwickelt:
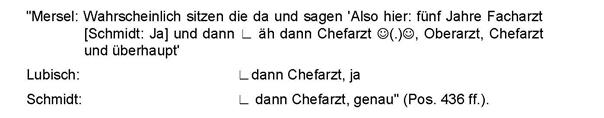
Frau Hausmann wirft hierauf ein, viele Medizinstudenten seien "inzwischen sehr weich", womit sie Karrierestreben mit Härte
gleichsetzt. Doch vermutlich sind die "weichen" Männer nicht attraktiv; denn sie fügt sogleich hinzu: "meiner nicht" (Pos.
441). Dagegen nähmen die "weichen Ärzte" ihre Rolle als Väter sehr ernst, wie Frau Mersel im unmittelbaren Anschluss formuliert.
Sie fragt, ob die "Herren der Schöpfung" sich im Rahmen einer solchen Diskussion ähnlich stark "irgendwie über Familie [...]
Gedanken mach[en]", worauf sich ein kurzer einvernehmlicher Dialog entspinnt. Die meisten wollten Kinder, doch machten sich
keine Gedanken über die "Modalitäten", über die "wir" uns Gedanken machen müssten (Pos. 443-446). [37]
Frau Hausmann bringt noch eine dritte Figur in das dualistische Bild ein, auf deren Unattraktivität sich alle einigen können: "diesen unheimlich diesen Chefarzt-Söhnchen-Studenten" (Pos. 447), der seine Frau zu Hause sitzen haben wolle. Dieser Prototyp ist für Frau Hausmann so unattraktiv, dass sie seine Bekanntschaft "verdrängt" habe (Pos. 450). Eine Funktion erfüllt er aber allemal: Die unangenehm zu werden drohende Sequenz über die eigenen Partner kann abrupt und mit dem Gefühl einer gemeinsamen Abgrenzung beendet werden. Die konsequente Übertragung der eigenen abstrakten Positionen auf die konkreten Lebensrealitäten würde einen Widerspruch offenbaren und müsste konsequenterweise in einen Konflikt mit den Partnern münden. Das Zerrbild verweist darauf, was konsensuell als Bedrohung wahrgenommen wird: als Ärztin auf ein Dasein als Mutter und Hausfrau zurückgeworfen zu werden. Die sowohl skandalisierende als auch ironisierende Form dieser dynamischen Sequenz, an der alle beteiligt sind, impliziert einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund. Die Bedrohung gilt mehr oder weniger allen, sie betrifft sie als "Frauen in der Medizin". So binnendifferenziert diese Identifikation auch sein mag, im Kern enthält sie einen nicht auflösbaren, nur kompromissfähigen Widerspruch zur Identifikation als Mutter und den damit verbundenen Implikationen. Das "Chefarzt-Söhnchen" repräsentiert neben der Elternschaft die Klinikstruktur und damit von zwei Seiten das Bedrohliche für "Frauen in der Medizin". Was dagegen den Imperativ der "guten Mutter" ausmacht, scheint so selbstverständliche Hintergrundfolie der Diskussion, dass nicht ausgeführt werden muss, was er umfasst. [38]
5.5 Widersprüche zur "Geschlechterproblematik"
In der letzten Sequenz setzt Frau Hausmann erneut mit der Grundfrage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie die Agenda. Arbeitsbedingungen müssten sich ändern, da immer mehr Ärztinnen in die Medizin drängten. Was als zusammenfassendes Abschlussplädoyer gedacht war, da es auf eine bis dahin als konsensuell empfundene Position aufbaut, erfährt nun durch Frau Lange den schärfsten Widerspruch der gesamten Diskussion.
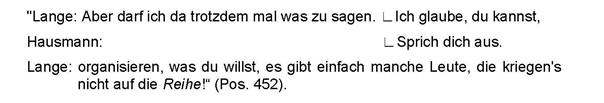
Frauen hätten es früher viel schwerer gehabt und diejenigen, die es heute als Ärztin nicht schaffen, so Frau Lange weiter,
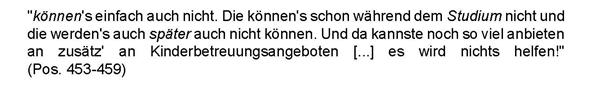
Aggressiv entwertend werden hier die Frauen beschrieben, die immer noch nicht stark genug seien, mit den Verbesserungen gut
leben zu können. In ihren Repliken verdeutlichen Frau Hausmann und Frau Lubisch, dass sich dieser Vorwurf implizit auch gegen
sie richtet:
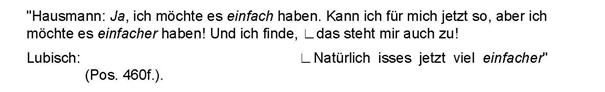
Dennoch widersprechen sie nicht inhaltlich, formulieren stattdessen oberflächliche Zustimmungen, woraufhin Frau Lange den
argumentativen Faden ändert. Sie äußert sich despektierlich über "das Märchen von Schweden", wo die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf gut möglich sei. Auch relativiert sie den Karrierebegriff, neben "Chefarztsein" gebe es "tausend verschiedene Auffassungen"
(Pos. 469) von Karriere. Schließlich spricht sie von einer "Pseudokarriere an der Uni" (Pos. 471), sodass die Relativierung
in die Entwertung von klassischer Karriere mündet. Gleichzeitig widerspricht Frau Lange vehement einer " Geschlechterproblematik",
die "herbeidiskutiert" (Pos. 477) werde. Den Verdacht, dass Frau Lange damit einen Widerspruch zwischen eigenem Anspruch und
Wirklichkeit rationalisiert, bestätigt sie selbst: "Vielleicht bin ich da auch einfach störrisch, ich will das einfach nicht akzeptieren" (Pos. 531). [39]
Eine Einigung zwischen den Teilnehmerinnen wird schließlich erzielt, wenn Frau Schmidt das Problem ungleicher Aufgabenverteilung in Partnerschaften thematisiert: "weil im Zweifelsfall is'er er nicht derjenige, der ja nach Hause kommen muss und die Kinder irgendwie von der KiTa abzuholen" (Pos. 509ff.). Frau Lange kann vollauf zustimmen: "Ja, aber das is, das is doch, da is doch genau das Problem" (Pos. 512). Es zeigt sich also, dass sie auf der manifesten Ebene nicht nur eine "Geschlechterproblematik" leugnet, sondern diese durchaus sieht und zwar innerhalb der privaten Beziehung. [40]
Während Frau Hausmann um ein integratives Modell der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ringt, hat sich Frau Mersel der Notwendigkeit eines temporären Kompromisses ergeben. Sie wolle erst "Arzt spielen" und dann als Mutter in Teilzeit arbeiten, weil sie nur so bei ihrem "Kind schon noch als Mutter durchgehen" könne (Pos. 545). Dabei konnotiert sie gleichzeitig die Rolle der Ärztin als das Lustvollere, weil Spielerische, während der Rolle als Mutter sowohl Ernst und Pflichterfüllung anhaftet als auch das "Authentische" im Gegensatz zum Spiel. Darüber hinaus ist der Arzt männlich und die ärztliche Rolle erscheint als Fremdes, Äußerliches und nicht als Teil des Selbstbildes, während die potenzielle Mutterrolle wie selbstverständlich als Hauptidentitätsquelle wirkt. [41]
Einzig Frau Schmidt und Frau Lange scheinen sich gegen die immanente Logik des Konfliktes zu wehren. Während Frau Schmidt das System der Medizinkarriere, das heißt v.a. die Krankenhausstrukturen mit ihren "verrückten Chefärzten" (Pos. 405) entwertet, das Reizvolle daran negiert und sich auf die Logik des Karrieremachens nicht einlassen will, negiert Frau Lange das Konflikthafte bzw. dessen immanente "Geschlechterproblematik". Die Entwertung der klassischen Klinikkarriere auf der einen und die der Frauen, die "es nicht schaffen", auf der anderen Seite verweist auf die Fragilität eines Selbst(ideal)bildes, das von Autonomiewünschen und -anforderungen geprägt ist wie vom historisch neuen Idealbild einer Mutter, die zeitlich und emotional für ihr Kind da sein, lustvoll in dieser Tätigkeit aufgehen und gleichzeitig noch beruflich erfolgreich sein solle (SCHÜTZE 2010). [42]
Gleichzeitig ist Frau Lange die einzige, die eine Konfliktbereitschaft gegenüber ihrem Partner zum Ausdruck bringt, also den Widerspruch einerseits leugnet, ihn andererseits in der eigenen Beziehung anerkennt. Daneben wird im Konsens ein geschlechtlich konnotiertes Problem bei gleichzeitiger Verleugnung dieser Dimension innerhalb der Paarbeziehung diskutiert. Beides hilft, das Drohpotenzial von widersprüchlichen beruflichen und geschlechtlichen Identifizierungen abzuschwächen: den Autonomiewünschen, dem Streben nach beruflichem Aufstieg, Anerkennung, Macht und Geld auf der einen Seite und der Identifizierung mit Mutterbildern auf der anderen Seite. [43]
Stellt sich in W1 Frau Lubisch zu Beginn als Mutter vor, so in M1 Herr Graf als Vater. Auch dieser bringt sofort die Schwierigkeit der Vereinbarkeit seiner beruflichen Ziele mit seiner Familie ein. Jedoch – und hier zeigt sich bereits ein entscheidender Unterschied – geht es ihm von vornherein um die schwierige Vereinbarkeit einer Karriere im engeren Sinne, dem Aufstieg zum Oberarzt an einer Uniklinik, während in W1 die Vereinbarkeit von ärztlichem Beruf in Vollzeit und ein Familienengagement allgemeiner infrage gestellt wird. Auch wird Letzteres für die PJlerinnen zum die Gruppe konstituierenden Thema. Dagegen wird der Konflikt von Herrn Graf von keinem der anderen Teilnehmer als mögliches eigenes Problem aufgegriffen. Diesen verschiedenen Gruppen- und Geschlechterdynamiken soll im Folgenden genauer auf den Grund gegangen werden. Dazu beleuchten wir zunächst, wie über Frauen gesprochen wird. [44]
6.1 Assoziation von "Frauen und Familie" versus egalitäre Modelle
Außer als "die Schwestern" (u.a. Pos. 56, 67) oder als "die Sekretärin" (u.a. Pos. 561) tauchen Frauen in der Debatte der Männer vereinzelt als Freundinnen und potenzielle Ehefrauen auf, als Ärztinnen jedoch vorwiegend gerade nicht. Zum Beispiel berichtet Herr Graf von der Betriebsfeier einer chirurgischen Abteilung: "Auf dieser Feier dort waren lauter Typen" (Pos. 445), ein Hinweis darauf, dass diese nicht von Partnerinnen begleitet wurden. Einzig Herr Scholler thematisiert hierauf ausdrücklich die Situation von Frauen in der Medizin. Er zitiert einen Chefarzt, der einen Mangel an chirurgischem Nachwuchs problematisierte, und spricht von Frauen, die das Fach grundsätzlich belegen wollten "aus emanzipatorischen Gründen, was auch immer" (Pos. 171). Dies führt ihn unmittelbar zur schwierigen Vereinbarkeit von Familie und ärztlichem Beruf: "Ähm ham die dann trotzdem auch ähm eher Familie und sind dann eher eingebunden und da wird überhaupt nicht darauf eingegangen" (a.a.O.). [45]
Wie in allen Diskussionen dieser ersten Erhebungswelle (vgl. ROTHE et al. 2012) werden auch hier Frauen gleichsam automatisch mit Familie assoziiert, und ihr Privatleben erscheint sogleich als Familienleben. Dies wird aber Herrn Scholler selbst unmittelbar bewusst, denn "auch [...] Männer [sind] vielleicht ähm stärker familiär eingebunden [...] und wer wenn man so ignorant ähm darüber weg geht" (Pos. 171). [46]
Beklagt werden Arbeitsbedingungen, die inkompatibel seien mit familiärer Einbindung von Müttern und Vätern, aber dennoch nicht verändert würden. Doch wird auch in der Gruppendiskussion über eine familiäre Einbindung von Männern bzw. Vätern "hinweggegangen" bzw. von keinem Teilnehmer aufgegriffen. Vielmehr schließt eine Passage an, in der beklagt wird, dass das PJ in der Regel nicht bezahlt werde. [47]
Auch die von Herrn Graf berichtete anstehende Entscheidung zwischen einer Uniklinik und einem "peripheren" Kreiskrankenhaus wird von keinem der Teilnehmer als mögliches eigenes Problem aufgegriffen, sondern konsequent beschwiegen und damit zu Herrn Grafs "Privatangelegenheit" gemacht. Der Konflikt von Herrn Graf, einerseits in die "Highend-Medizin" an der Uniklinik einsteigen zu wollen, um "dort große Chirurgie zu lernen" (Pos. 463), was andererseits "einen großen Verzicht im Privatleben" (Pos. 51) impliziere, interessiert nur im Hinblick auf allgemeine Arbeitsbedingungen. So wenig wie sich die anderen Teilnehmer als Väter bzw. Partner imaginieren, so sehr werden Frauen nur als "die Schwestern", "Sekretärin" oder Partnerinnen bzw. Ehefrauen genannt. [48]
Erst im letzten Drittel der Diskussion wird die Verknüpfung von Berufs- und Privatleben durch einen Moderator wieder eingeführt, der sich dabei direkt an Herrn Graf wendet:
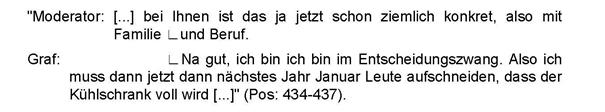
Aus der Entscheidung zwischen Uniklinik und peripherem Haus, die Herr Graf zuvor als konflikthaft geschildert hatte, wird
nun ein Zwang, um die Familie ernähren zu können. Das Bild, "Leute auf[zu]schneiden" (Pos. 435), um den Kühlschrank zu füllen,
ist ein Gewaltvolles. Das Aufschneiden in der Chirurgie steht hier nicht mehr im Kontext des Heilens – zuvor hatte Herr Graf
davon gesprochen – vielmehr wird die Assoziation nahegelegt, es seien die aufgeschnittenen Leute selbst, die den Kühlschrank
füllten. In der Gruppe erntet es allgemeines Gelächter, nachdem Herr Kohlhaas den Beitrag von Herrn Graf als "herrliche Metapher"
(Pos. 438) bezeichnet hat. Hier scheint das Bild des traditionellen "Familienernährers"13) auf, das Herr Graf aggressiv im Kontext eines empfundenen Karriereabstrichs einbringt. Es tritt an die Stelle des Sprechens
über den Kompromiss, an ein "kleines Haus" zu gehen, mit dem Herr Graf offenbar hadert. [49]
Wir stellen deshalb die Frage, ob das Betonen von traditioneller "Männlichkeit" an dieser Stelle deren impliziter Bedrohung entgegensteht. Doch zunächst sei der weitere Verlauf dieser Sequenz betrachtet, in dem schließlich Herr Ammer auf das "Privatleben" im Allgemeinen bzw. in der dritten Person zu sprechen kommt, für das bei Forschung und Klinikversorgung kaum noch Zeit bleibe. Er spricht dabei nicht von sich, sondern zunächst über seinen Chef und führt daraufhin abstrakt "die Frau" ein, die "dann [...] irgendwann" sage:
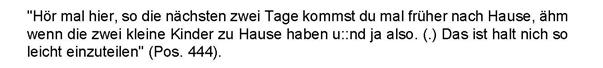
Als Spiegelbild zum "Familienernährer" taucht hier erneut das Bild der Frau als Familientragende auf, die diesen Bereich auch
mit Forderungen vertritt und dem überlasteten Arzt noch zusätzlich Stress bereite. Doch imaginiert sich Herr Ammer nicht selbst
als Vater, spricht stattdessen abstrakt von "der Frau", die zu Hause in "ihrem" traditionellen Bereich auf den Mann warte.
[50]
Dies veranlasst Herrn Graf, von der bereits erwähnten "Betriebsfeier" zu erzählen, auf der "lauter Typen [...] ohne Anhang" (Pos. 445) gewesen seien, was wiederum Herr Scholler als "abschreckendes Beispiel" (Pos. 456) bezeichnet. Er wolle Karriere machen und "sich privat verwirklichen" (Pos. 453). Dass dies eventuell nicht möglich sei und zu einer Entscheidung zwischen beiden Bereichen zwinge, bringt er damit in Verbindung, dass es nicht mehr so sei "wie früher, dass die Frauen zu Hause sitzen und kochen. Das ist halt jetzt anders" (Pos. 456). [51]
Herr Graf bestätigt, dass es "jetzt auch Oberärzte [gebe], die halt in den Mutterschutz gehen so ungefähr- oder wie heißt das, in in Elternzeit. Ja" (Pos. 457). Er schweigt aber über sich. Herr Ammer hingegen kann sich gut "vorstellen für ein halbes Jahr oder so" (Pos. 458) in Elternzeit zu gehen. Denn, so seine Erwartung an eine zukünftige Partnerin:
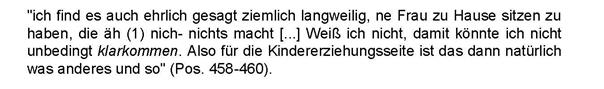
Auf einer expliziten, aber abstrakten Ebene wird wie selbstverständlich ein nicht traditionelles Beziehungs- und Rollenmodell
affirmiert, das bis auf die Tatsache, dass die Frau dann arbeite, aber unbestimmt bleibt:
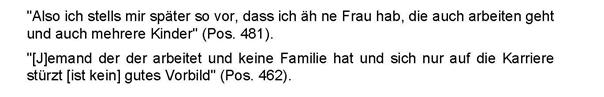
Wir interpretieren diese Passagen als Indiz dafür, dass von den Teilnehmern ein neues "gesellschaftliche[s] Ideal der Gleichberechtigung"
(KERSCHGENS 2010, S.5) in Paarbeziehungen geteilt wird. Doch stellen die Diskutanten die Selbstverständlichkeit einer gleichberechtigten
Verantwortung und "Zuständigkeit" infrage, wenn es um das Großziehen von Kindern geht; denn "für die Kindererziehungsseite
ist das dann natürlich was anderes". Auch bei Herrn Graf, der insgesamt wenig konkret über sein Privatleben spricht, erscheint
seine Familie als eher traditionell organisiert. Er ist der "Ernährer", der den Kühlschrank füllt, und die Frau, die offenbar
zumindest in Teilzeit berufstätig ist, folgt ihm und seinem Karriereverlauf: Seine künftigen Arbeitgeber "wollen mich unbedingt
haben. ☺Die wollen mich so sehr, dass sie meiner Frau auch ne Stelle frei gemacht haben☺" (Pos. 51). [52]
So wenig sich die anderen Teilnehmer bereits konkret als Väter imaginieren, so sehr antizipieren sie bereits eine auch statistisch verbreitete Retraditionalisierung des Paararrangements, sobald sie Eltern werden.14) [53]
6.2 "Glamour" versus "Scheißjob" oder gar Tod: bedrohte "Männlichkeit"?
Im letzten Drittel der Diskussion bringt Herr Graf wieder seinen persönlichen Konflikt zwischen der "glanzvollen" Unikarriere und dem Arbeiten an einem peripheren Haus ein. Er stehe "ganz konkret vor der Sache". Doch hadere er auch mit der Entscheidung, denn er wolle "auch keinen "Scheißjob machen". Die Tätigkeit, die es Herrn Graf ermöglicht, seine "Kinder [nicht erst] wieder [zu] sehe[n], wenn sie's Abitur machen" (Pos. 463), birgt offenbar aber diese Gefahr. In dieser Frage ist Herr Ammer sich mit Herrn Graf einig und weist diesen darauf hin, indem er direkt auf den "Scheißjob" reagiert: "Machste ja jetzt schon, wenn du sagst du ☺willst ins Kreiskrankenhaus☺(2)☺" (Pos. 464). [54]
Dass Herr Graf nicht zu jenen gehört, die die "Allergrößten [sind], wenn die eine Wirbelsäule operieren, und das jeden Tag" (Ammer, Pos. 472), wird von Herrn Ammer genüsslich als Degradierung ausgewiesen. Herr Graf ist also nicht nur keiner der "Allergrößten", sondern macht im "kleinen Haus" entwürdigende Arbeit, einen "Scheißjob". Er wird von Herrn Ammer als schwache und getriebene Person dargestellt, die mit ihren "manuellen Fertigkeiten" nicht Herr der Lage sei und "Großes" vollbringe, sondern von den Umständen beherrscht werde:
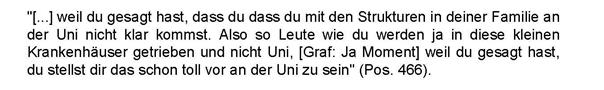
Herr Ammer kehrt in diesem Beitrag die Argumentationsfigur, nach der die Strukturen an der Uniklinik problematisch für die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind, um. Herr Graf komme wegen der Strukturen in seiner Familie an der Uni nicht klar.
Hier erscheint die Familie als das Problem, das "Leute wie" ihn in die kleinen Häuser treibe, nicht die Arbeitsorganisation.
[55]
Das Bild, das Herr Graf an die Stelle des "Glamour[s]" der "Highend-Medizin" und "große[n] Chirurgie" setzt, ist das des "Familienernährers", der die "Leute aufschneidet". Doch wird er jetzt von Herrn Ammer auch als dieser entwertet, indem er dadurch einen "Scheißjob" am Kreiskrankenhaus mache. [56]
Die Attribute, die Herr Graf mit der "große[n] Chirurgie" verknüpft, lassen an das von CASSELL (1998, S.100) gezeichnete (Ideal-) Bild des männlich konnotierten Heldentypus denken. Das Bild des "Familienernährers", der "Leute aufschneidet", lässt sich ebenso als Männlichkeitsfantasie lesen, wie auch in weiteren Passagen nahegelegt wird. Beispielsweise stellt Herr Graf das Invasive, also wörtlich "Eindringende" der chirurgischen Tätigkeit in Gegensatz zur Inneren Medizin15), in der man allgemein "wenig" mache:
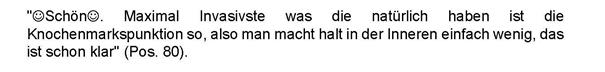
Mit der Interpretation, dass sich die Aggression im Bild "Leute aufzuschneiden" aus dem "Verzicht" (Pos. 51) speist, den Herr
Graf mit seinem Kompromiss eingeht, lässt sich das Aufschneiden auch als männlich konnotiert lesen: eine Männlichkeit, die
gegen deren potenzielle Bedrohung durch den Verzicht zusätzlich aggressiv "aufgeladen" wird. Demnach würde diese Männlichkeit
potenziell bedroht durch den "Verzicht im Privatleben" (Pos. 51). [57]
Das von Herrn Graf gezeichnete Bild des idealen Arztes bzw. Chirurgen dagegen entspricht dem Ideal des autonomen, vollständig unabhängigen Mannes. Es entspricht dem Idealtypus des "iron surgeon" (CASSELL 1998, S.100), der "powerful, invulnerable, untiring" und von einem geheimnisvollen Nimbus umgeben sei (a.a.O.). Für Herrn Graf umgibt den Chirurgen der Uniklinik "Glamour" (Pos. 467), mit dessen Verzicht er sowohl hadert als ihn auch für sich reklamiert. Gleichzeitig rechtfertigt er diesen Verzicht, indem er die langfristige Belastung des Arbeitens als Chirurg an der Uniklinik betont: Er wisse, wie "das verschleißt" (Pos. 467). Aus dem Kontext lässt sich dies auf die Tätigkeit an der Uniklinik in seiner Position als Familienvater beziehen; das Gegenbild dazu jedoch ist der vollkommen unabhängige Mann:
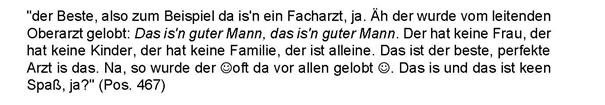
Zitiert wird hier ein Ideal-Bild des perfekten Mannes, der "Großes" vollbringt, ohne durch andere behindert zu werden oder
gar von diesen abhängig zu sein. Selbst wenn der Satz vom Oberarzt scherzhaft gemeint sein sollte – für Herrn Graf kann er
dies nicht sein, trifft er doch direkt dessen Konflikt, sich durch seine Familie in der Chirurgenkarriere eingeschränkt zu
sehen. Er kann niemals dieser "perfekte Arzt" sein, wenn er Frau und Kinder hat. [58]
Unvermittelt und ohne zu kontextualisieren erzählt Herr Graf kurz darauf eine "coole Story" (Pos. 532), die wir ebenfalls im Kontext einer imaginierten Bedrohung von Männlichkeit interpretieren. Umrahmt vom eigenen Lachen, berichtet er von einem Chirurgen, der erst
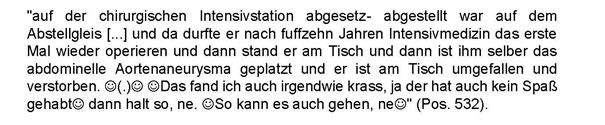
Das "Abstellgleis" lässt sich auf der einen Seite als Äquivalent zum "Scheißjob" bzw. zur von Herrn Graf anvisierten Tätigkeit
an einem "kleinen Haus" verstehen und würde in dieser Interpretation letztlich durch den Tod bedroht. Auf der anderen Seite
könnte die Szene dazu dienen, die Entscheidung für das kleine Haus zu rechtfertigen und aufzuwerten; denn hier sieht Herr
Graf die Möglichkeit gegeben, "Eingriffe [zu] machen" (Pos. 469), invasiv zu sein, während dem Arzt in der Geschichte diese
Möglichkeit für viele Jahre entzogen wurde. Diesen trifft erst der Tod nach einer langen Auszeit. Dennoch folgt er auf das
(wieder) Invasiv-sein-Dürfen. So wäre es in dieser Interpretation das für Herrn Graf männlich konnotierte Operieren, das Invasive,
auf das der Tod folgt. [59]
Beiden Interpretationen gemeinsam ist die Bedrohung einer Männlichkeit, die zuvor als großartig fantasiert wurde. Doch wird nicht deutlich, durch wen diese letztlich erfolgt. Ist es die Familie, die den Chirurgen zu einem "Scheißjob" zwingt? Oder sind es die Arbeitsbedingungen und ihre Durchsetzung durch Vorgesetzte? Beide Möglichkeiten sind im Material angelegt. [60]
Zentraler für unsere Fragestellung ist jedoch, ob eine solche Bedrohung bestehende Machtstrukturen in der Medizin grundsätzlich infrage stellt. Zunächst sei dazu festgehalten, dass die anderen vier Teilnehmer nicht in die Auseinandersetzung zwischen Herrn Ammer und Herrn Graf einsteigen. Sie bleiben unaufgeregt und nicht erschüttert oder bedroht. Beispielsweise wendet sich Herr Scholler explizit gegen das idealisierte Heldenbild des Chirurgen, wenn er sich vom "heroische[n] Geist" abgrenzt, bei dem es darum gehe: "wie lange halte ich durch" (Pos. 302). Auch werden im Konsens Vereinbarkeitsmodelle von ärztlichem Beruf und Familie diskutiert, die als Folge von veränderten Geschlechterrollenarrangements gesehen werden. Darüber hinaus konstituiert sich die Gruppe bei allen Differenzen und aller Auseinandersetzung wie selbstverständlich als nach wie vor männliche Norm der Ärzteschaft. Dazu gehört, dass diese Männlichkeit nicht thematisiert wird, weil sie als Norm vorausgesetzt ist. Im folgenden und letzten Abschnitt der komparativen Analyse soll es um diese geteilte Identifikation als (angehende) Ärzte gehen. [61]
6.3 Status, Anerkennung, Geschlecht: eine autoritär-paternalistische Orientierung
Die Identifikation mit der Ärzteschaft wird vor allem in Abgrenzung zu anderen Statusgruppen und in erster Linie in Abgrenzung zur "anderen Seite" der Medizin deutlich: den Patient_innen. Diese tauchen in der Gruppendiskussion weder als Personen auf, noch werden sie über ihre Krankheiten oder ihre Organe individualisiert, sondern verschwinden hinter den Prozeduren, die an ihnen vorgenommen werden. Neben dem Aufschneiden sind sie präsent in durchzuführenden Blutentnahmen, dem Legen von "Flexülen16)" (Pos. 84), einzugipsenden Kinderarmen, "vierhundert Säuglingshüften, die wir ultra äh ultrageschallt haben" (Pos. 418), anzuhängenden Infusionen und zu stellenden Diagnosen. Demgegenüber stehen insgesamt drei Schilderungen individueller Geschichten, die jeweils eine Ausnahme bilden. Alle drei Geschichten enden mit dem Tod der besagten Person, und nach allen drei Geschichten wird keine Anteilnahme am Schicksal der Verstorbenen geäußert. Im Kontrast zur Geschichte, die mit dem Tod des Arztes endet, geht es in der zweiten und dritten Geschichte um den Tod von Patient_innen aufgrund von ärztlichen Fehlern: Eine Patientin verstarb infolge fehlender Utensilien bei einer Reanimation. Wenngleich Herr Ammer zunächst die Perspektive der Patientin einnimmt (es sei "nicht lustig", wenn man selbst Patient sei), wird der Vorfall vor allem unter der Frage diskutiert, welcher der Ärzte die Verantwortung übernehmen müsse (Graf, Pos. 106) und welche Rolle der Chefarzt innehabe. In der letzten Patientengeschichte geht es um den Suizid eines Patienten nach einer Diagnose. Herr Ammer führt diesen auf die nicht stattgefundene Kommunikation zwischen Arzt und Patient zurück und schließt mit dem Satz: "Und das fand ich schon sehr äh lustig, wie so ein Todesfall ☺zustande kommt☺" (Pos. 598). [62]
Die in den Schilderungen enthaltene Teilnahmslosigkeit gegenüber den jeweils tödlich endenden Schicksalen hat jede emotionale Dimension der leidvollen Geschichten ausgelöscht, wie sie auch in den Darstellungen der Klinikerfahrungen nicht vorkommen. Die Identifikation mit der Medizinerseite ist vollständig vollzogen, ebenso die Abgrenzung zur "anderen Seite", den Patient_innen. Hierdurch wird die Zugehörigkeit zur Gruppe der Ärzt_innen markiert. In der medizinsoziologischen Literatur wird ebenfalls die Funktion von "Horrorgeschichten" (SANDER 2009, S.279) als Abstecken von Professionsgrenzen diskutiert – allerdings zwischen Pflegepersonal bzw. "Schwestern" und "Ärzten". SANDER hebt hier die "dual boundary-work function" (ALLEN, zit. n. SANDER a.a.O.) hervor, was bedeutet, dass die Professionsgrenze zugleich eine Geschlechtergrenze markiert (a.a.O.). Auch in unserem Material dienen diese Geschichten unter anderem der Selbstversicherung des Status als Arzt. Dabei kommt dem Umgang mit Leid, Sterben und Tod eine wichtige Funktion zu: Das Lachen über die Todesfälle sowie das Nicht-Beachten des Leides und der Individualität der Personen lässt sich verstehen als Abwehr von Angst vor Leid und Tod. Möglicherweise ist eine solche Abwehr eine psychosoziale Voraussetzung für den ärztlichen Beruf, und die Teilnehmer der Gruppendiskussion demonstrieren mit ihrer Sprechweise, dass sie sie erfüllen. [63]
Dass der ärztliche Prototyp nach wie vor als männlicher Arzt repräsentiert ist, zeigt sich in der Gruppendiskussion in der Art und Weise, wie über das Pflegepersonal und die zugeteilten Aufgaben sowie Gratifikationen gesprochen wird. Das Pflegepersonal wird in der Diskussion fast durchgängig als "die Schwestern" verhandelt und in verschiedenen Stereotypien gezeichnet. Sie tauchen u.a. als Sexualobjekte der wie selbstverständlich männlichen Ärzte17) auf (Herr Kohlhaas, Herr Graf und Herr Ammer, Pos. 446ff.). [64]
Die "Schwestern" dienen außerdem dazu, den Status der PJler als "so'n Zwischending zwischen Schwestern und Ärzten" (Lorenz, Pos. 67) zu markieren, was den höheren Status der Ärzte und der PJler gegenüber den Schwestern impliziert. Bei dieser Statusdefinition durch Absetzung von den Schwestern tun sich insbesondere Herr Lorenz und Herr Scholler hervor. Zwar beklagt Herr Scholler die geringe Entlohnung der Pflegekräfte (Pos. 499), doch erscheinen sie auch als diejenigen, die eine effektive Organisation des Klinikablaufes behindern, was mit einer schlechten Arbeitsmoral in Verbindung gebracht wird (a.a.O.). Die identifikatorische Abgrenzung gegenüber den Schwestern wird v.a. daran deutlich, dass sich darüber empört wird, die Aufgaben übertragen zu bekommen, die eigentlich Sache des Pflegepersonals seien.
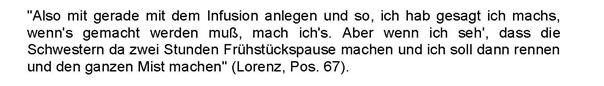
Was sich vordergründig als Beschwerde über die schlechte personelle Ausstattung und schlechte Organisation liest, aufgrund
derer die PJler dann "Schwesternarbeit" machen müssten, wird gleichzeitig als Problem mangelnder Anerkennung deutlich. In
ihren Berichten fühlen sie sich nicht in ihrer Ausbildung gewürdigt, und ein Teil der Klage richtet sich darauf, in ihrem
Status als (werdende) Ärzte unangemessene Tätigkeiten übernehmen zu müssen. Deutlich äußert dies neben Herrn Lorenz Herr Scholler,
für den Anerkennung ein wichtiges Motiv ist. Diese Anerkennung könne er durch eine monetäre Gratifikation erfahren, aber auch
durch die soziale Anerkennung seiner Leistung (Pos. 56). [65]
Es zeigt sich eine grundsätzliche autoritär-paternalistische Orientierung. So seien zwar die "steilen Hierarchien [...] fürchterlich ätzend" (Graf, Pos. 80), gleichzeitig aber brauche man jemanden, der "das Ruder in der Hand hat" (Pos. 129). Auch sind die Untergebenen von den Vorgesetzten abhängig im Hinblick darauf, anerkannt und angeleitet zu werden. Letzteres wird vor allem als Organisationsproblem der Ausbildung (Ammer, Pos. 84) diskutiert. Zum einen gibt es den Appell an die "Obrigkeit", dass die Organisationsprobleme gelöst werden. Zugleich ist die Anerkennung der eigenen Leistung abhängig von den Vorgesetzten. Dass in diesem Zusammenhang immer nur Männer als Vorgesetzte und potenziell Anerkennende auftreten, halten wir für einen Ausdruck dieser autoritär-paternalistischen Orientierung. [66]
Wie nun lässt sich diese geteilte Orientierung der Männerdiskussion in Verbindung bringen mit der oben analysierten Bedrohung von "Männlichkeit" im Kontext der Erzählungen von Herrn Graf? Wir haben die Frage gestellt, ob eine sogenannte "Feminisierung" bestehende "maskuline" Machtstrukturen in der Medizin grundsätzlich infrage stellt oder gar bedroht. Die Rede von der "Feminisierung der Medizin" setzt sowohl die "Maskulinität" des Feldes voraus als auch deren Veränderung durch die Erhöhung des Frauenanteils in der Medizin. Das Material unserer Gruppendiskussionen verweist auf eine nach wie vor maskuline Norm im Selbstverständnis der angehenden Ärztinnen und Ärzte. [67]
Die Männerrunde konstituierte sich als Gruppe der Ärzteschaft bei allen Differenzen und aller Auseinandersetzung wie selbstverständlich als männliche Norm. Als zentral für die Gruppendynamik haben wir gezeigt, dass zwei Teilnehmer, Herr Graf und Herr Ammer, eine von Konkurrenz und Aggression geprägte Atmosphäre herstellten, die im Verlauf der Diskussion eskalierte. Dagegen zeigten sich die anderen vier Teilnehmer weitgehend unbeeinflusst von dieser Auseinandersetzung, diesem Konkurrenzkampf um die führende Position in der Gruppe. Dies lässt sich wiederum auf die verschiedenen Karriereorientierungen rückbeziehen. Lediglich die beiden Streitenden sind karriereorientiert – zwischen ihnen geht es also um den Kampf um die machtvollere Position in der Gruppe. In einem weiteren Rahmen lässt sich dieser auch auf die zukünftige Konkurrenz um die machtvollere Position im System der Medizin beziehen. Dass dieses System nach wie vor maskulin konnotiert ist, daran besteht für keinen ein Zweifel. Diese Maskulinität scheint nicht bedroht. [68]
Auch die vier weniger karriereorientierten Männer der Gruppe fühlten sich weder durch den Machtkampf zwischen Herrn Graf und Herrn Ammer noch durch die Frauen oder veränderte Rollenverteilungen zwischen den Geschlechtern bedroht. Als bedroht empfand sich lediglich der angehende Chirurg, da er aufgrund seiner Familie dem Ideal eines unangefochtenen, vollkommen unabhängigen "Heldentypus" nicht entsprechen kann. [69]
Die Teilnahmslosigkeit gegenüber dem Statuskampf verweist nicht auf hegemoniale Männlichkeit; doch wird diese als Ideal auch nicht infrage gestellt. Vielmehr lässt sich mit CONNELL (2005, S.79) von "Männlichkeiten" sprechen, die, selbst nicht hegemonial, die Hegemonie doch mit reproduzieren oder stützen. Wir möchten deshalb abschließend die Orientierungen dieser vier Teilnehmer genauer betrachten. Dabei fassen wir "hegemoniale Männlichkeit(en)" als Ideal, zu dem sich Individuen auf verschiedene Weise positionieren und positioniert werden. Es geht uns nicht darum, Einzelne verschiedenen Typen von Männlichkeiten zuzuordnen.18) [70]
Die Teilnehmer zeigen Unterschiede in ihrer Positionierung zur hegemonialen Männlichkeit. Herr Kohlhaas lässt sich als opportunistisch beschreiben, wenn er beispielsweise nicht in die Beschwerden der anderen über mangelnde Bezahlung bei starker Arbeitsbelastung einstimmt, sondern seinen Arbeitswillen betont (Pos. 274-278).19) Herr Scholler stützt eine traditionell-paternalistisch hegemoniale Männlichkeit, indem er Anerkennung durch die männlichen Vorgesetzten begehrt. Herr Lorenz und Herr Sänger dagegen scheinen stärker Hegemonie-distanziert; Ersterer betont seine Freizeitorientierung (s.o.), während Letzterer den uneingeschränkten Zugriff auf sich und seine Arbeitskraft verweigert20). [71]
Bleibt lediglich der "Kampf" zwischen Herrn Graf und Herrn Ammer um zwei verschiedene Versionen von machtvoller Männlichkeit. Lässt sich das von Herrn Graf gezeichnete Idealbild des "iron surgeon", gleichzeitig verknüpft mit traditionell paternalistischen Machtstrukturen, als "altes" hegemoniales Ideal lesen, so vertritt Herr Ammer stärker die Orientierung am Ideal eines neueren "neoliberalen" Typus (vgl. CONNELL 2005, S.xxiv) des autonomiebetonenden, selbstständigen und flexiblen Unternehmers, der eine traditionell-hegemoniale Männlichkeit infrage stellt. [72]
Wie deutlich wurde, offenbart sich in der Diskussionsgruppe W1 eine geteilte Identifikation als Ärztin, immer noch zugleich als "Frau in der Medizin" "das andere Geschlecht" (BEAUVOIR 1949) in der Medizin zu sein. Dies ist konflikthaft, da es sich aus zwei kontradiktorischen Identifikationen speist. Die Widersprüchlichkeit ist interindividuell verschieden, erscheint einmal als schwierige Herausforderung, ein anderes Mal als unversöhnlicher Antagonismus. Das Selbstbild der angehenden Ärztinnen kann auf den gemeinsamen Nenner gebracht werden, einer jungen Generation anzugehören, der die ärztliche Tätigkeit zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Dieser Identifikation einer autonomen Frau steht wie als Drohung das Bild der "guten Mutter" (SCHÜTZE 2010) gegenüber, mit dem sich offenbar alle, zumindest antizipatorisch, identifizieren. Kennzeichen dieses Bildes ist eine immanente Alleinerziehungsfunktion, da die Väter in jeder Erzählung auf die eine oder andere Weise "verschwinden". Die Identifikationen mit Mutterbildern stehen nach wie vor den beruflichen Identifikationen entgegen, während Vaterschaft und Arztsein keinen identifikatorischen Widerspruch aufweisen. Insgesamt erscheint zwar ein neues gesellschaftliches egalitäres Ideal in Paarbeziehungen durchgesetzt, aber lediglich als diskursiver Bezugsrahmen, nicht in der Realisierung. [73]
Neben der Voraussetzung, als Frau in der Medizin vor besonderen Herausforderungen zu stehen, gewinnt Geschlechtlichkeit auf zwei weiteren Ebenen an Bedeutung. Zunächst wird eine männliche Dominanz der Klinikstrukturen beklagt und der Wunsch, eine klassische Karriere innerhalb dieser Strukturen zu machen, mit (empirischen) Männern in Verbindung gebracht. Zugleich machen Frau Lubisch und Frau Schmidt die Antizipation besonderer Karrierehemmnisse in Form einer geringeren Karriereerwartung zum Spezifikum von Frauen in der Medizin. Der Wunsch und die realistische Möglichkeit, innerhalb der Medizin Karriere zu machen, werden nicht nur durch männliche Ärzte repräsentiert, sie werden auch mit einem männlichen Habitus konnotiert, denn "weich sein" wird zum unmittelbaren Gegenteil der "Härte" und "Männlichkeit" der "Herren der Schöpfung" mit unterstelltem Karrierestreben. Diese Attribute Karrierestreben, Härte, Männlichkeit verlören aber in dem Moment ihre Gebundenheit ans phänomenologische Geschlecht, in dem sie für die heutige Generation junger Ärztinnen erreichbar würden. Dass dies als männlich attribuiertes Verhalten erstrebenswert und lustvoll besetzt ist, wird deutlich, wenn der Zwang zur Entscheidung zwischen Karriere und Familie eben nicht als Wahlmöglichkeit, sondern als Problem beschrieben wird, das männliche Ärzte nicht hätten21) – eine beneidenswerte Situation also. [74]
Wenn man also den Begriff der "Feminisierung" auf den Kontext der vorliegenden Diskussion überträgt, kann in dem Moment davon gesprochen werden, in dem Ärztinnen Ansprüche auf eine Karriere innerhalb der Medizin stellen. Sie werden jedoch zu Frauen in der Medizin, wenn sie als potenzielle Mütter inkompatibel mit dem System und seinen Anforderungen werden. Feminisierung wird so zu einem Begriff, dem der vermeintliche Widerspruch von Frauen und Medizin immanent ist. Dies übernehmen die Teilnehmerinnen in ihre subjektive Betrachtung und erleben die Forderungen des (potenziellen) Mutterdaseins selbst als solch einen Widerspruch zu ihren beruflichen Ambitionen. [75]
Hegemoniale Männlichkeit wird nicht herausgefordert durch eine zunehmende Feminisierung, wenn diese die Zunahme des Anteils von Ärztinnen beschreibt, sondern steht in den Aspekten infrage, die ein prototypisches Bild eines Mediziners setzen: Dieser ist voll und ganz mit seinem Beruf identifiziert und speist seine berufliche und männliche Identifikation innerhalb einer sozialen Struktur hauptsächlich aus dem Arztsein. Andere identifikatorische Bereiche wie Vaterschaft stehen scheinbar nicht im Widerspruch zur beruflichen Identifikation. Essenzieller Teil dieses Aspektes ist neben dem selbstverständlichen Aufgehen die Selbstausbeutung zugunsten der beruflichen "Mission". Das diese fordernde System wird von den Teilnehmerinnen der Gruppendiskussion W1 in selbstverständlich männlichen "Chefärzten" repräsentiert gesehen. Die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit beinhaltet aber weiterhin ein Faszinosum, auch wenn von diesem bisweilen ein "heiliger Schauer" ausgeht, der das Wahrnehmen der Mutterrolle unmöglich zu machen scheint.22) [76]
Die grundsätzlich für angehende Ärztinnen attraktive berufliche Habitusformation, ausgerichtet am Ideal hegemonialer Männlichkeit (CONNELL 1987), verliert scheinbar ihre Bindung ans zugewiesene Geschlecht, indem sie formal allen Mediziner_innen zugänglich wird. Die zur Forderung geronnene Veränderung des beruflichen (Selbst-) Verständnisses entsteht aber durch extramedizinische Anforderungen an die angehenden Ärztinnen und ist somit ein notwendiger und somit auch negativ besetzter Kompromiss. Da dies innerhalb der hier vorgestellten Diskussion im Zusammenhang der potenziellen Mutterschaft der Teilnehmerinnen geschieht, tritt es in einem Moment auf, der – anders als der übliche Gebrauch – als Moment der "Feminisierung" bezeichnet werden kann. [77]
Dieser Beitrag stellt einen Ausschnitt der Ergebnisse unserer Längsschnittstudie dar. Er bildet innerhalb unseres Samples den maximalen Kontrastbereich des Selbstverständnisses von angehenden Ärztinnen und Ärzten zum Ende ihres Studiums ab. Wir verstehen die Kontrastanalyse als hilfreich, um für das Milieu des Medizinstudiums und der Uniklinik Typisches im Hinblick auf berufliche sowie geschlechtliche Identifikationen und Konflikte herauszukristallisieren. Innerhalb des aufgezeigten Spektrums ist von vielen Zwischenstufen und Schattierungen auszugehen, die es in weiterer Forschung mithilfe minimaler Kontrastierungen herauszuarbeiten gilt. [78]
1) So betrug der Anteil der Medizinstudentinnen in Deutschland im Wintersemester 2013 60,6% (STATISTISCHES BUNDESAMT 2014). Allerdings bleiben Ärztinnen in leitenden Positionen im klinischen wie im wissenschaftlichen Bereich nach wie vor in der Minderheit (GEMEINSAME WISSENSCHAFTSKONFERENZ 2013). Diese Entwicklung findet sich gleichermaßen u.a. für Deutschland, die Schweiz (BUDDEBERG-FISCHER 2001), Frankreich (COUFFINHAL & MOUSQUÈS 2001) und die USA (BOULIS & JACOBS 2008). <zurück>
2) Karriereverläufe und Karrierebrüche bei Ärztinnen und Ärzten während der fachärztlichen Weiterbildung (KarMed): Die an der Universität Leipzig und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf angesiedelte Studie wurde gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) (Förderkennzeichen 01FP1241, 01FP1242, 01FP1243, 01FP1244). Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autor_innen. <zurück>
3) Alle PJler und PJlerinnen an diesen Kliniken waren per E-Mail kontaktiert und zur Teilnahme eingeladen worden. <zurück>
4) Freie Assoziation ist die Aufforderung an eine Person, alles zu sagen, was ihr in den Sinn kommt. Sie wurde von FREUD (1975 [1912], S.171) als "Grundregel" der klinischen Psychoanalyse eingeführt. <zurück>
5) Der psychoanalytische Begriff der Identifikation bezeichnet den vorwiegend unbewussten Mechanismus, "durch den das menschliche Subjekt sich konstituiert" (LAPLANCHE & PONTALIS 1999 [1973], S.220). Zweitens ist für das psychoanalytische Denken der Gedanke der Regression zentral, das heißt, dass wir immer auf lebensgeschichtlich frühere Formen des Erlebens und Verhaltens zurückfallen, bzw. dass wir diese stets in uns tragen. Bereits FREUD betonte mehrfach, dass auch die frühen Modi der Identifizierung qua Regression immer wieder hergestellt werden können (LAPLANCHE & PONTALIS 1973, S.223). Geschlechtliche (sowie später auch berufliche) Identitäten sind das Resultat komplexer und oft konflikthafter Identifikationen. <zurück>
6) Alle verwendeten Namen sind Aliasnamen. <zurück>
7) Als periphere Häuser werden im Medizin-Jargon Lehr-Krankenhäuser bezeichnet, die nicht an eine Universität angebunden sind. <zurück>
8) Zum Begriff der Karriereorientierung in dieser Studie siehe ROTHE et al. (2012). <zurück>
9) In dieser Diskussion wurde als "klassische Karriere" ein Aufstieg an einer Universitätsklinik definiert. Die Position einer Chefärztin/eines Chefarztes an einem solchen Haus ist die statushöchste Position. <zurück>
10) Legende zur Transkription:
(.) – Pausenzeichen unter zwei Sekunden.
"(2)" – Zahlenangaben in Klammern markieren Sekunden.
"(Pos.)" – steht für die Position des jeweiligen Zitats im Datenverarbeitungsprogramm MAXQDA.
“☺” – markiert Lachen.
"∟" – markiert gleichzeitiges Sprechen zweier oder mehrerer Personen.
Kursivsetzungen markieren Betonungen. <zurück>
11) In den Gruppendiskussionen W1 wie auch M1 wurden lediglich heterosexuelle Beziehungen diskutiert. <zurück>
12) Frau Kaya ist die Einzige in der Gruppe, die explizit keine Kinder haben möchte. Sie hält sich in ihren Redebeiträgen eher zurück, sodass die dominierende Tendenz vom Topos der (potenziellen) Mutterschaft getragen wird. <zurück>
13) Vgl. BERESWILL (2008, S.106) zur "Verknüpfung zwischen Männlichkeit und Erwerbsarbeit" als nach wie vor verankertem kulturellen Leitbild in westlichen Industriegesellschaften. <zurück>
14) Vgl. MEUSER (2005) zum massiven Auseinanderklaffen von Realität und Anspruch in Bezug auf das Paararrangement im Zusammenhang mit geteilter aktiver Elternschaft. <zurück>
15) Die Konstruktion der Chirurgie als "maskulines Fach" gegenüber der Inneren Medizin als "feminin" analysiert auch CASSELL (1998, S.340ff.). <zurück>
16) Eine Flexüle ist ein Venenkatheter einer bestimmten Marke. <zurück>
17) So fragt Herr Kohlhaas auf Herrn Grafs Erzählung von der Betriebsfeier, auf der die Ärzte "ohne Anhang" gewesen seien, ob auch "Schwestern eingeladen" gewesen seien (Pos. 446). Herr Graf bejaht, worauf Herr Kohlhaas dies als Grund für die Ärzte, dort alleine aufzutauchen, benennt. Dies erntet Gelächter durch Herrn Graf und Herrn Ammer (Pos. 447ff.). <zurück>
18) JEFFERSONs Kritik zufolge wird der Begriff der "hegemonialen Männlichkeit" fälschlicherweise häufig attributional statt relational verwendet (2002, S.70). <zurück>
19) "Aber, das heißt doch praktisches Jahr. Ich mein, ist das so schlimm, zu arbeiten? [...] Mir macht's nichts aus, da einfach wirklich zu arbeiten, acht Stunden lang Aufnahmen zu machen uns so weiter" (Kohlhaas, Pos. 274-278). <zurück>
20) "Wir können ruhig auf unsere Rechte (.) pochen. Es gibt da so'ne PJ-Ordnung, wo drin steht wir dürfen nicht zu Tätigkeiten rangezogen werden, wenn sie nicht unserer Ausbildung dienen" (Sänger, Pos. 268). <zurück>
21) Schmidt: "Ich glaub die Geschlechterproblematik is nur einfach, dass'n Mann sich darüber keine Gedanken machen muss, [Mersel: Genau] weißt du?" (Pos. 507) <zurück>
22) Hausmann: Weil ich halt auch denke, dafür is unser' der Anfang bei uns, so wenn du dann Assistenzarzt bist und diese ganzen Nachtschichten, ich glaube, das is auch gerade im ersten Jahr, weil man ständig Angst hat, jemanden ☺umzubringen☺ [Gelächter] ist es glaub ich einfach besonders schlimm [...] Genau, umbringen könnte, ☺ja☺. Also ich weiß, ich ich äh denke, das wird' das wird ziemlich schlimm. Und ich glaube, den zusätzlichen Belastungen eines Kindes wäre ich nicht (.)' also das wär für das Kind auch ☺gefährlich, sag ich mal so☺" (Pos. 311ff.). <zurück>
Beauvoir, Simone de (1949). Deuxième sexe: Les faits et les mythes [Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau]. Paris: Gallimard.
Bereswill, Mechthild (2008). Geschlecht. In Nina Baur, Hermann Korte, Martina Löw & Markus Schroer (Hrsg.), Handbuch Soziologie (S.97-116). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Bohnsack, Ralf (1997). Gruppendiskussionsverfahren und Milieuforschung. In Barbara Friebertshäuser & Annedore Prengel (Hrsg.), Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft (S.492-502). Weinheim: Juventa.
Boulis, Ann K. & Jacobs, Jerry A. (2008). The changing face of medicine: Women doctors and the evolution of health care in America. Ithaca, NY: ILR Press.
Bourdieu, Pierre (2009 [1976]). Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Brandes, Holger (2004). Hegemoniale Männlichkeit und männlicher Habitus. Thesen zu Connell und Bourdieu. Diskussionspapier zur 3. AIM-Gender-Tagung, Stuttgart, 13.-15.12.2004.
Brinkschulte, Eva (2006). Historische Einführung. Medizinstudium und ärztliche Praxis von Frauen in den letzten zwei Jahrhunderten. In Susanne Dettmer, Gabriele Kaczmarczyk & Astrid Bühren (Hrsg.), Karriereplanung für Ärztinnen (S.9-35). Heidelberg : Springer Medizin.
Buddeberg-Fischer, Barbara (2001). Karriereentwicklungen von Frauen und Männern in der Medizin. Schweizerische Ärztezeitung, 82(35), 1838-1848.
Buddeberg-Fischer, Barbara; Stamm, Martina; Buddeberg, Claus & Klaghofer, Richard (2008). Möglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung der Hausarztmedizin aus der Sicht junger Ärztinnen und Ärzte. Das Gesundheitswesen, 70(3), 123-128.
Cassell, Joan (1997). Doing gender, doing surgery. Women surgeons in a man's profession. Human Organization, 56(1), 47-52.
Cassell, Joan (1998). The woman in the surgeon's body. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Connell, Raewyn W. (1987). Gender and power. Cambridge, CA: Stanford University Press.
Connell, Raewyn W. (2005). Masculinities (2. Aufl.). Berkeley, CA: University of California Press.
Couffinhal Agnès & Mousquès, Julien (2001). La démographie médicale française: état des lieux [Die ärztliche Demografie in Frankreich: eine Bestandsaufnahme]. Questions d'Economie de la Santé, 44, 1-6.
Decker, Oliver; Rothe, Katharina; Weißmann, Marliese; Geißler, Norman & Brähler, Elmar (2008). Ein Blick in die Mitte. Zur Entstehung rechtsextremer und demokratischer Einstellungen in Deutschland. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.
Foucault, Michel (1988 [1973]). Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Freud, Sigmund (1975 [1912]). Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung. In Sigmund Freud, Studienausgabe. Ergänzungsband. Schriften zur Behandlungstechnik (S.169-180). Frankfurt/M.: Fischer.
Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (2013). Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung. 17. Fortschreibung des Datenmaterials (2011/2012) zu Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen. Bonn: Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK), http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Papers/GWK-Heft-34-Chancengleichheit.pdf [Datum des Zugriffs: 4.10.2015].
Jefferson, Tony (2002). Subordinating hegemonic masculinity. Theoretical Criminology, 6(1), 63-88.
Kerschgens, Anke (2010). Zum widersprüchlichen Wandel des Geschlechterverhältnisses: Arbeitsteilung in Familien. Journal für Psychologie, 18(1), 1-24, http://www.journal-fuer-psychologie.de/index.php/jfp/article/view/170/168 [Datum des Zugriffs: 9.11.2015].
Kilminster, Sue; Downes, Julia; Gough, Brendan; Murdoch-Eaton, Deborah & Roberts, Trudie (2007). Women in medicine: Is there a problem? A literature review of the changing gender composition, structures and occupational cultures in medicine. Medical Education, 41(1), 39-49.
Laplanche, Jean & Pontalis, Jean-Bertrand (1999 [1973]). Das Vokabular der Psychoanalyse. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Leithäuser, Thomas & Volmerg, Birgit (1988). Psychoanalytische Sozialforschung. Opladen: Leske und Budrich.
Löchel, Elfriede (1997). Inszenierungen einer Technik: Psychodynamik und Geschlechterdifferenz in der Beziehung zum Computer. Frankfurt/M.: Campus.
Lorenzer, Alfred (1986). Tiefenhermeneutische Kulturanalyse. In Hans-Dieter König, Alfred Lorenzer, Heinz Lüdde, Sören Nagbohl, Ulrike Prokop, Gunzelin Schmid Noerr & Annelinde Eggert, Kultur-Analysen (S.11-98). Frankfurt/M: Fischer.
Lorenzer, Alfred (1995 [1973]). Sprachzerstörung und Rekonstruktion. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Meuser, Michael (2005). Vom Ernährer der Familie zum "involvierten" Vater? Zur ambivalenten Modernisierung von Männlichkeit. Figurationen. Gender – Literatur – Kultur, 6(2), 91-106.
Meuser, Michael (2009) Hegemoniale Männlichkeit – Überlegungen zur Leitkategorie der Men's Studies. In Brigitte Aulenbacher, Mechthild Bereswill, Martina Löw, Michael Meuser, Gabriele Mordt, Reinhild Schäfer & Sylka Scholz (Hrsg.), FrauenMännerGeschlechterforschung. State of the Art (Forum Frauen- und Geschlechterforschung, Bd.19, S.160-174). Münster: Westfälisches Dampfboot.
Morgenroth, Christine (2001). Die Untersuchung unbewusster Gruppenprozesse. Über die kollektive Dimension innerer Vergesellschaftungsformen. In Detlev Claussen, Oskar Negt & Michael Werz (Hrsg.), Hannoversche Schriften Band 4. Philosophie und Empirie (S.194-220). Hannover: Verlag Neue Kritik.
Pringle, Rosemary (1998). Sex and medicine: Gender, power and authority in the medical profession. Cambridge: Cambridge University Press.
Reichenbach, Laura & Brown, Hilary (2004). Gender and academic medicine: Impacts on the health workforce. BMJ, 329(7469), 792-795.
Rothe, Katharina (2009). Das (Nicht-)Sprechen über die Judenvernichtung. Psychische Weiterwirkungen des Holocaust in mehreren Generationen nicht-jüdischer Deutscher. Gießen: Psychosozial.
Rothe, Katharina; Wonneberger, Carsten; Deutschbein, Johannes; Pöge, Kathleen; Gedrose, Benjamin & Alfermann, Dorothee (2012). Von Ärzten, Ärztinnen und "Müttern in der Medizin". In Sandra Beaufays, Anita Engels & Heike Kahlert (Hrsg.), Einfach Spitze? Neue Geschlechterperspektiven auf Karrieren in der Wissenschaft (S.312-334). Frankfurt/M.: Campus.
Salling Olesen, Henning (Hrsg.) (2012). Cultural analysis and in-depth hermeneutics – Psycho-societal analysis of everyday life culture, interaction, and learning. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 13(3), http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/issue/view/41 [Datum des Zugriffs: 4.10.2015].
Sander, Kirsten (2009). Profession und Geschlecht im Krankenhaus. Soziale Praxis der Zusammenarbeit von Pflege und Medizin. Konstanz: UVK.
Schütze, Yvonne (2010). Mutterbilder in Deutschland. Psychoanalyse. Texte zur Sozialforschung, 14(2), 179-195.
Statistisches Bundesamt (2014). Studierende nach Nationalität und Geschlecht im Zeitvergleich. Studienfach Medizin, https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Bildung/lrbil05.html [Datum des Zugriffs: 4.10.2015].
Katharina ROTHE, Dr. phil., Dipl.-Psych. ist Sozialforscherin und niedergelassene Psychologin und Psychoanalytikerin in New York City. Sie hat gerade ihre psychoanalytische Ausbildung am William Alanson White Institute in New York abgeschlossen.
Kontakt:
Katharina Rothe, PhD
226 W 26th St.
8th floor, room 11
New York, 10036, NY
USA
Tel.: 001-347-821-7200
Fax: 001-212-362-6967
E-Mail: rotkathz@gmail.com
URL: http://rotkathz.wix.com/extraordinary-alien#
Johannes DEUTSCHBEIN, Mag. art. der Kulturwissenschaften, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft an der Charité-Universitätsmedizin Berlin.
Kontakt:
Johannes Deutschbein
Charité - Universitätsmedizin Berlin
Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft
Luisenstraße 13
10117 Berlin
Tel.: 0049-30-450-529089
E-Mail: johannes.deutschbein@charite.de
Carsten WONNEBERGER, Dipl.-Psych. arbeitet derzeit in Leipzig an einem Promotionsprojekt zum Thema "Der Tod und die moderne Medizin – zum Wandel von Heil und Heilung" sowie als wissenschaftlicher Berater für die Healthcare GmbH und als psychologischer Gutachter.
Kontakt:
Carsten Wonneberger
Brockhausstr. 19
04229 Leipzig
E-Mail: carsten.wonneberger@medizin.uni-leipzig.de
Dorothee ALFERMANN, Univ. Prof., Dr. phil., Dipl.-Psych., Projektleiterin des Leipziger Teilprojekts von KarMed. Koautorin (zusammen mit Ursula ATHENSTAEDT) des Buchs "Geschlechterrollen und ihre Folgen. Eine sozialpsychologische Betrachtung", Stuttgart: Kohlhammer, 2011.
Kontakt:
Prof. Dr. phil. Dorothee Alfermann
Universität Leipzig
Jahnallee 59
04109 Leipzig
Tel.: 0049-341-97-31633
Fax: 0049-341-97-31639
E-Mail: alfermann@uni-leipzig.de
URL: http://www.spowi.uni-leipzig.de/fakultaet/institute-fachgebiete/psychpaed/personal/prof-dr-dorothee-alfermann/
Rothe, Katharina; Deutschbein, Johannes; Wonneberger, Carsten & Alfermann, Dorothee (2016). Zwischen "Arzt spielen", "Work-Life-Balance"
und "Highend-Medizin". Wird "hegemoniale Männlichkeit" in der Medizin herausgefordert? [78 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 17(1), Art. 15,
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1601159.