

Volume 6, No. 1, Art. 8 – Januar 2005
"Gibt es Willensfreiheit?" Möglichkeiten der psychologischen Vergegenständlichung von "Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit"
Uwe Laucken
Zusammenfassung: Die Frage, ob den Menschen die Willensfreiheit gegeben sei, ist eine uralt-strittige Frage. Sie wird von einigen Neurowissenschaftlern erneut aufgeworfen. Der Artikel setzt sich mit den Argumenten jener Neurowissenschaftler auseinander, die behaupten, die Existenz der Willensfreiheit experimentell falsifiziert zu haben.
Um Existenzaussagen machen zu können, muss man über grundsätzliche Existenzmöglichkeiten nachdenken. Dieses Nachdenken nimmt einen großen Teil des Artikels ein. Es werden drei Denkformen unterschieden, die sich durch einen jeweils eigenen Gegenstandsmodus auszeichnen. Wie, so wird anschließend gefragt, lässt sich die Willensfreiheit in diesen Gegenstandsmodi so vergegenständlichen, dass jeweils die Frage ihrer Existenz oder Nicht-Existenz sinnvoll gestellt werden kann.
Dabei zeigen sich kennzeichnende Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten. So erweist es sich, dass die Willensfreiheit als lebenspraktischer Tatbestand im physischen Kosmos der Neurowissenschaften grundsätzlich keinen gegenständlichen Ort finden kann. Aussagen, die Willensfreiheit gebe es nicht, sind somit innerhalb dieser physischen Denkform tautologisch richtig. Sie empirisch zu belegen, erweist sich als Pseudoempirie. Anders sehen die gegenständlichen Unterbringungsmöglichkeiten in den beiden anderen Denkformen, der semantischen und der phänomenalen, aus. Aber auch im Kosmos der semantischen Denkform gibt es Probleme.
Schließlich wird gefragt, wie sich die Gegenstandsentwürfe der drei Denkformen so aufeinander beziehen lassen, dass es aufschlussreich ist, "Wie-ist-es-möglich?"-Fragen aufzuwerfen und zu erforschen.
Keywords: Willensfreiheit, Möglichkeiten der Vergegenständlichung, Denkformen, Erklärungsweisen, Pseudoempirie
Inhaltsverzeichnis
1. Neurosophische Gegenaufklärung: Die vierte Kränkung der Menschheit?
2. Versuche einer empirisch-wissenschaftlichen Falsifikation der Willensfreiheit
3. Erörterte Varianten der Willensfreiheit, vergleichende Betrachtung und Gemeinsamkeiten
3.1 Spontaneitätswillensfreiheit
3.2 Unterbindungswillensfreiheit
3.3 Besinnungswillensfreiheit
3.4 Gemeinsame Bestimmungsmomente der drei Varianten der Willensfreiheit
4. Psychologische Denkformen, ihre Gegenstandsentwürfe und Ermöglichungsbeziehungen
4.1 Basissemantische Differenzen wissenschaftlichen Erkennens
4.2 Ein Beispiel unterschiedlicher Vergegenständlichungen
4.3 Physische Denkform und ihr Gegenstandsmodus
4.4 Einige Implikationen der Eigenart des Gegenstandsentwurfs der physischen Denkform
4.4.1 Nicht-physische Größen als Erkenntnismittel
4.4.2 Erster Versuch der gegenständlichen Verortung: Pendeln zwischen Korrelation und Kausalität
4.4.3 Zweiter Versuch der gegenständlichen Verortung: "Geist als physikalischer Zustand"
4.4.4 Dritter Versuch der gegenständlichen Verortung: "Geist als Eigenschaft der Materie"
4.4.5 Schlussfolgerung
4.5 Semantische Denkform und ihr Gegenstandsmodus
4.6 Einschub: Willensfreiheit als semantisch prozessiertes Konstrukt
4.7 Die phänomenale Denkform und ihr Gegenstandsmodus
4.8 Ermöglichungsbeziehungen zwischen den Gegenstandsentwürfen verschiedener Denkformen und "Wie-ist-es-möglich?"-Fragen
5. Denkformen und ihre Möglichkeiten, Willensfreiheit zu vergegenständlichen
5.1 Willensfreiheit und die physische Denkform
5.1.1 Willensfreiheit als erkenntnisgegenständliche Größe im physischen Kosmos
5.1.2 Willenfreiheit als Merkmal physischer Größen
5.1.3 Willensfreiheit als eine Größe in der Rubrik der Erkenntnismittel
5.1.4 Willensfreiheit als strikt paralleles phänomenales Geschehen
5.1.5 Die falsifikatorische Irrelevanz LIBETscher Untersuchungen
5.1.6 Schlussfolgerungen
5.2 Willensfreiheit und die semantische Denkform
5.3 Willensfreiheit und die phänomenale Denkform
5.4 Willensfreiheit und ermöglichungstheoretische Überlegungen
6. Neurosophische Gegenaufklärung: Sich selbst auf den Leim gehen!
Der Artikel sei mit einer Warnung begonnen. Die Warnung ist ein Geständnis. Auf die Frage, ob es Willensfreiheit gibt oder nicht, wird der Artikel keine Antwort geben. Deshalb taucht die Frage danach in der Überschrift in Anführungszeichen gesetzt auf. Es geht hier um diese Frage als solche und wie mit ihr zurzeit umgegangen wird. Was der folgende Text liefern soll, sind Beurteilungen von Antworten, die für sich den Anspruch erheben, die Frage nach der Existenz oder Nicht-Existenz der Willensfreiheit schlüssig und empirisch belegt beantworten zu können. Vor allem sind es Neurowissenschaftler, die sich solche Antworten zutrauen. Zwar kann der Artikel nicht sagen, ob es Willensfreiheit gibt oder nicht, er kann aber sagen, wie die neurowissenschaftliche Behauptung einzuschätzen ist, es gebe die Willensfreiheit nicht. [1]
|
Ergänzung Der Text ist mit einigen "Ergänzungen" durchsetzt. Was es damit auf sich hat, sei kurz erläutert. Zum Zustandekommen dieses Artikels hat dreierlei beigetragen: eine massenmedial pulsierenden Diskussion, eine Buch und eine Anfrage. Zum Ersten: Wie sich gleich zeigen wird, ist die Frage nach der Willensfreiheit seit einigen Jahren wieder einmal en vogue. Beispielhaft zeigt sich dies in einer umfangreichen (und wohl noch nicht beendeten) Reihe von Beiträgen, die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen sind, beginnend mit einem Beitrag von Klaus LÜDERSSEN vom 4.11.2003. Seither findet in der F.A.Z. ein munteres argumentatives Ping-Pong-Spiel statt. Gibt es sie oder gibt es sie nicht, die Willensfreiheit? Was hieße es, wenn es sie nicht gäbe, z.B. für das Prozessieren des Rechtssystems? Ist das, wovon die Neurowissenschaftler reden, überhaupt die Willensfreiheit, die wir meinen? ... und so weiter. Zum Zweiten: Gegen Ende des Jahres 2003 ist ein Buch, das ich verfasst habe, erschienen. Es handelt von Fragen zur Theoretischen Psychologie. In diesem Buch erörtere ich verschiedene Denkformen der Psychologie und deren jeweilige explanativen und praktischen Möglichkeiten und Grenzen. Dabei kommt auch, aber eher beiläufig, die Frage nach der Erforschung der Willensfreiheit zur Sprache. Zum Dritten: Um die Jahreswende 2003/2004 haben Barbara ZIELKE und Hans WERBIK bei mir nachgefragt, ob ich Lust hätte, zum Thema der Willensfreiheit einen Vortrag an der Universität Erlangen-Nürnberg zu halten. Ich hatte Lust. Von da an dachte ich gründlicher nach, recherchierte und verfolgte aufmerksam die öffentlichen Diskussionen. Das derzeitige Resultat ist dieser Artikel. Zum Inhalt des Artikels haben auch die Fragen beigetragen, die mir von Zuhörern meines Vortrags, den ich am 17. Juni 2004 hielt, gestellt wurden. Einige Fragen konnte ich, so hoffe ich, unmittelbar beantworten. Über andere musste ich erst gründlicher nachdenken. Die Ergebnisse dieses Nachdenkens sind sichtbar in den Text eingeflossen. Ich habe sie wie diese "Ergänzung" hier markiert. Diese Art, mit den Ergänzungen separat umzugehen, soll auch eine Absicht zum Ausdruck bringen: Ich betrachte den Text nicht als abgeschlossene Denkeinheit, sondern als einen ausbaufähigen Denkansatz. Viele Fragestellungen, die in den F.A.Z.-Beiträgen erörtert wurden, erfahren eine thematische Umstrukturierung, wenn man sie in einer Weise aufschlüsselt, die ich hier vorschlage. Und ich hoffe natürlich, dass diese Art der Aufschlüsselung größere Gedankenklarheit zu bringen vermag. [2] |
1. Neurosophische Gegenaufklärung: Die vierte Kränkung der Menschheit?
Begonnen sei mit ein paar Hinweisen darauf, warum das Thema der Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit wieder einmal aktuell geworden ist. Für die geeigneten materialen Voraussetzungen sorgte zweierlei. [3]
Zum einen sind da die Ausläufer der "Dekade des Gehirns", die der US-Senat vor nunmehr etwa einem Vierteljahrhundert ausgerufen hat, um die neurobiologische Forschung gezielt finanziell zu fördern. Dies liefert die ökonomischen Voraussetzungen. [4]
Zum anderen ist da die Entwicklung geeigneter Geräte, der so genannten bildgebenden Verfahren. Dies liefert die technischen Voraussetzungen. [5]
Wie stets, wenn wissenschaftlich epochale neue Geräte geschaffen werden (z.B. das Elektronenrastermikroskop) gibt es ein Flut von Untersuchungen (oft anfänglich wenig theoriebasiert), die die neuen Erfassungsmöglichkeiten hier, da und dort ausprobieren. Ökonomische und technische Voraussetzungen zusammen lieferten den Nährboden für einen neurowissenschaftlichen Forschungsboom, der sich rund um den Erdball ausbreitete, bis nach Deutschland. [6]
|
Ergänzung Meinem Kollegen, dem Biologen Horst Kurt SCHMINKE verdanke ich den Hinweis, dass bereits Ernst HAECKEL Mitte des 19. Jahrhunderts darauf hinwies, dass es in geräteabhängigen Wissenschaften kennzeichnende Forschungskonjunkturen gibt, mit typischen Anfangsmängeln. Seinerzeit ging es um technische Verbesserungen optischer Mikroskope. Diese förderten, so beklagte HAECKEL, das bloße Anhäufen großer Mengen empirischen Materials: "Dieser Irrthum wurde dadurch insbesondere begünstigt, dass die verbesserten Instrumente und Beobachtungsmethoden der Neuzeit, und vor Allem die sehr verbesserten Mikroskope, der empirischen Naturforschung ein unendlich weites Feld der Forschung eröffneten, auf welchem es ein Leichtes war, mit wenig Mühe und ohne grosse Gedanken-Anstrengung, Entdeckungen neuer Formverhältnisse in Hülle und Fülle zu machen ... die erklärende Gedanken-Arbeit (wurde) von den meisten völlig vergessen ..." (HAECKEL, ca. 1860, S.6). [7] |
Zwischenzeitlich gewonnene neurobiologische Erkenntnisse ermutigen einige Wissenschaftler, Fragestellungen aufzugreifen, die seit Jahrtausenden erörtert werden (vgl. SCHNÄDELBACH, 2004), vorrangig von Philosophen, ohne sie bislang letztgültig beantworten zu können. Gerade diese fast unerträglich lange Erörterungsdauer zeige, wie Gerhard ROTH (2000) meint, dass es an der Zeit sei, sich derartiger Fragen empirisch anzunehmen. Nur empirisch-wissenschaftlich lasse sich klären, ob es etwas gibt oder nicht. Und bei der Willensfreiheit ist es die Wissenschaft vom Gehirn, die erforschen könne, ob es sie gebe oder nicht. Wie die Antwort dieser Wissenschaft nach Meinung ROTHs lautet, wurde kürzlich im Zweiten Deutschen Fernsehen einem Massenpublikum erläutert. [8]
Am 28. März 2004, kurz vor Mitternacht, konnte das Fernsehpublikum aus dem Munde Gerhard ROTHs (er hat eine Professur für Verhaltensphysiologe an der Universität Bremen inne) vernehmen, dass all die Menschen, die da glauben, sie seien – zumindest gelegentlich - frei darin, sich zu entscheiden, dies, das oder jenes zu tun, einer Illusion aufsitzen. Peter SLOTERDIJK (Philosoph und Moderator des "Philosophischen Quartetts") kommentierte diese Erkenntnis als die vierte Kränkung, welche die empirische Wissenschaft der Menschheit zugefügt habe. KOPERNIKUS riss sie aus der Mitte des Universums. DARWIN machte sie zu einer Horde nackter Affen. Und FREUD degradierte sie zu Marionetten unbewusster Kräfte. Und nun sind die Neurobiologen dran. Sie rauben den Menschen einen Leitstern ihres Selbstverständnisses, die Willensfreiheit: "On this is founded ... almost the whole conduct of life", meinte im Jahre 1739 der schottische Philosoph David HUME (vgl. 1955, S.182). Dieses durch die "Aufklärung" propagierte Selbstverständnis des Menschen, welches aus ihm beispielsweise einen mündigen Bürger macht, der für sein Tun und Lassen verantwortlich ist, wird nun von manchen Neurobiologen als fälschliche Selbsterhöhung entlarvt. "Das neue Wissen über die neuronale Mechanik unseres Denkorgans sollte den philosophischen Glauben an das selbstbestimmte Individuum als Vorurteil entlarven", so heißt es in einem resümierenden Bericht der Süddeutschen Zeitung (Nr. 113, S.12) vom 17. Mai 2004 über ein Diskussions-Forum zum Thema "Wie frei ist der Mensch?" – mit dabei: Gerhard ROTH. [9]
Im Philosophischen Quartett werden Themen diskutiert, die im Schwange sind. Für die Erörterung der besagten "Vierten Kränkung der Menschheit" gilt das besonders. Seit etlichen Jahren füllen die Weisheiten einiger Neurowissenschaftler den Medienraum, mit zunehmender Tendenz. Ein paar Zitate lassen den Tenor der öffentlichen Diskussion erkennen:
Mit folgenden Worten spricht CRICK (1997) (der Mitentdecker der Doppelhelix-Stuktur der DNS) die Leser seiner Betrachtungen zur naturwissenschaftlichen Erforschung des Bewusstseins an: "Sie, Ihre Freuden und Leiden, Ihre Erinnerungen, Ihre Ziele, Ihr Sinn für Ihre eigene Identität und Willensfreiheit – bei alledem handelt es sich in Wirklichkeit nur um das Verhalten einer riesigen Ansammlung von Nervenzellen und dazugehörigen Molekülen" (S.17).
Das ist ein Fall einer "ontological reduction" (SEARLE, 1992, S.113), hier (unter anderem) der Willensfreiheit, auf neurobiologische Prozesse. So wie ein Stuhl nichts anderes ist als eine Ansammlung geordneter Moleküle, so ist die Willensfreiheit nichts anderes als eine Ansammlung aktivierter Nervenzellen. Daraus ergibt sich: Alles, was es über die Willensfreiheit zu sagen gibt, lässt sich ebenso gut (oder besser) über das "Verhalten" von Nervenzellen sagen. So trägt man zur "Entmystifizierung" der Willensfreiheit bei: "To figure out when and where volitions (or acts of the will) take place in the brain is thus essential to examining whether volitions really exist, thereby demystifying the concept of volition" (ZHU, 2004, S.304).
Gezielt die Entscheidungs- und Handlungsfreiheit nimmt Wolf SINGER (2000) (Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt a. M.) aufs neurowissenschaftliche Korn: "Die Annahme ..., wir seien voll verantwortlich für das, was wir tun, weil wir es auch anders hätten tun können, ist aus neurobiologischer Sicht unhaltbar" (S.44). Daraus folgert der Rechtswissenschaftler Klaus LÜDERSSEN, laut Wiedergabe seiner Meinung in der Süddeutschen Zeitung (2004, Nr. 113, S.12): "Für unser Rechtssystem sind die Entdeckungen der Hirnforschung ... dramatisch".
Gleichsinnige Erkenntnisse bringt auch Gerhard ROTH unters Volk, und zwar so massiv und erfolgreich, dass ihm dafür am 3.3.2003 sogar die Urania Medaille verliehen wurde. Sie wird an Wissenschaftler vergeben, die sich um die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse verdient gemacht haben. So klärt uns ROTH wieder und wieder darüber auf, dass die Annahme, wir Menschen seien (zumindest bei passender Gelegenheit) frei, so oder so zu handeln, "wohl eine Illusion (ist)" (2000, S.250). "Die Hirnforschung befreit von (solchen, U.L.) Illusionen" heißt es in der Überschrift eines Zeitungsartikels von ROTH (F.A.Z. vom 1.12.2003). Und schlüssig folgert er: "Einem Mörder individuelle Schuld zuzuschreiben, ist absurd" (ROTH, 2003, zit.n. Der Spiegel, 2/2003, S.25). [10]
Diese neurosophische Weisheit wiederholt ROTH denn auch in dem besagten Philosophischen Quartett. In der Rechtsprechung, so meint er, sei es unsinnig, Verantwortungs- und Schuldfragen klären zu wollen. Wer dies tut, jagt einer Illusion nach. Was Richter sinnvollerweise tun können, ist: Normverstöße feststellen und Strafen verhängen. SLOTERDIJK kommentierte dies so: Straftaten sind aus neurobiologischer Sicht Naturkatastrophen, und so sollte man mit ihnen umgehen. [11]
|
Ergänzung Die Willensfreiheit zur Illusion zu erklären, ist übrigens keine Besonderheit mancher Neurowissenschaftler. Ich will hier nur zwei Alternativbeispiele geben. Erstes Beispiel: Manche Sozialwissenschaftler, vor allem solche, die sozialfunktionale Analysen zwischenmenschlichen Handelns thematisieren, haben die Neigung, Handlungen einzelner Menschen als funktional geforderte Bestandteile sozial koordinierter Interaktionsnetze anzusehen. Das glatte Funktionieren dieser Interaktionsnetze lässt den einzelnen Interakteuren kaum Handlungsspielräume. Für das Handeln so eingebundener Akteure gilt sodann: "If agents' actions are determined then decision is an illusion" (POTTER, 2002, S.240). Entscheidungen, dies oder das zu tun, sind nicht frei, sondern sie ergeben sich aus Intentionen, die den Menschen durch ihre Stellungen in einem Interaktionsnetz vorgegeben sind. "Es gibt Handlungen, und diese Handlungen erfolgen innerhalb von Beziehungen, die ihnen ihren Sinn verleihen" (GERGEN, 2002, S.169). Überspitzt ließe sich sagen, dass das Handeln der Menschen und ihre Intentionen so geschaltet werden, wie es das Prozessieren des Interaktionsnetzes verlangt. "(D)ie Macht (als eine interaktive Beziehungsart, U.L.) geht durch die Individuen hindurch ..." (FOUCAULT, 2003, S.238). Entscheidungs- und folglich Willensfreiheit werden so zur Illusion erklärt. Zweites Beispiel: Hier wird die Willensfreiheit nicht sozialfunktional illusioniert, sondern individualfunktional als Schein entlarvt. Wie den Zitaten von ROTH und SINGER zu entnehmen ist, hängen Willensfreiheit und Rechtsprechungspraxis eng zusammen. So verwundert es nicht, dass sich auch Kriminologen dieses Themas annehmen. So hat DANNER (1968) eine Schrift verfasst, die "Warum es keinen freien Willen gibt" betitelt ist. Seine Begründung umfasst fünf "thesenhafte Sätze" (S.7).
Und ein determiniertes Wollen ist nicht frei. Aus diesen "Thesen" leitet DANNER sodann Folgerungen für die "Erziehung und Kriminalprophylaxe" (S.68) ab, die jenen Folgerungen gleichen, die ROTH uns (s.o.) anempfiehlt. DANNER propagiert: "Kein Schuldvorwurf, nur Missbilligung, und keine vergeltende 'Strafe', sondern nur erzieherische (= determinierende) Maßnahmen" (ebd.), die auch in Strafen bestehen können. – Hier ließe sich nun als drittes Beispiel der Illusionierung des Willensfreiheit SKINNERs "Beyond Freedom and Dignity" (1971) anschließen ... und so weiter. Ich will all diese Auffassungen hier nicht kommentieren. Ich will hier nur beispielhaft erwähnen, dass das Illusionieren der Entscheidungs- und Willensfreiheit kein Privileg der Neurowissenschaftler ist. [12] |
2. Versuche einer empirisch-wissenschaftlichen Falsifikation der Willensfreiheit
So weitgehende Schlussfolgerungen zieht man als Wissenschaftler wohl nur, wenn man sich seiner Sache sicher ist. Und Sicherheit ziehen Naturwissenschaftler aus experimentellen Untersuchungen und deren Befunden. Und so beruft sich denn auch ROTH (2004a) auf eine Vielzahl von Laborexperimenten "über 'willentliche' Handlungssteuerung" (S.133). Und sie alle haben ergeben: "Es gelingt nicht, irgendeinen Kausalzusammenhang zwischen dem Gefühl, etwas frei zu wollen (oder gewollt zu haben) und einer bestimmten Handlung nachzuweisen" (ebd.). [13]
Die Laboruntersuchungen, von denen Roth spricht, gehen auf Experimente des Neurobiologen Benjamin LIBET zurück. Der Untertitel eines Artikels besagt bereits sein Erkenntnisergebnis: "The unconscious initiation of a freely voluntary act" (LIBET u.a., 1983, S.623). Wie sieht das Experiment aus, aus welchem LIBET so weitreichende Schlüsse zieht? [14]
Die Versuchspersonen werden in dem Experiment aufgefordert, sich hinzusetzen und eine Art Uhr zu fixieren. Auf ihr kreist ein einzelner Zeiger (konkret: ein Lichtpunkt). Eine Runde dauert etwa zweieinhalb Sekunden. Die Versuchspersonen werden zudem aufgefordert, eine willentliche Bewegung zu vollführen. Sie sollen ein Handgelenk beugen (bei einer späteren Untersuchung ist es ein Finger). In der Versuchsinstruktion heißt es, sie sollen dies "freely and capriciously" tun. Hat eine Versuchsperson die instruierte Bewegung vollzogen, so kreist der Zeiger noch kurzzeitig und stoppt dann. Nun soll die Versuchsperson sich erinnern und berichten, in welcher Position auf dem Zeigerblatt der Zeiger sich befunden hat, als sie sich bewusst wurde, dass sie ihr Handgelenk (oder ihren Finger) beugen will. Der so bestimmte Zeitpunkt wird auf einer Zeitachse markiert. LIBET nennt ihn "awareness of intention". [15]
Gleichzeitig werden elektrophysiologische Messungen vorgenommen. Hier interessiert lediglich die Messung des so genannten Bereitschaftspotenzials ("readiness potential"). Das Bereitschaftspotenzial wird nicht-invasiv an der Schädeloberfläche abgeleitet (wie beim EEG). Das Bereitschaftspotenzial ist ein negatives elektrisches Potenzial, dass sich im Millisekundenbereich vor jeder Aktivierung motorischer Bahnen aufbaut und über den Kortex ausbreitet. [16]
Die entscheidenden Daten sind Zeitpunktvergleiche: der Zeitpunkt des Beginns des Aufbaus eines Bereitschaftspotenzials und der Zeitpunkt der Intentionsgewahrwerdung (den ebenfalls gemessenen Zeitpunkt des Beginns der Bewegungsausführung kann ich hier unberücksichtigt lassen). Vergleicht man beide Zeitpunkte auf der Zeitachse, so zeigt sich, dass die Intentionsgewahrwerdung im Durchschnitt 350 ms nach dem Beginn des Aufbaus des Bereitschaftspotenzials auftaucht. Daraus folgert LIBET (1999), zunächst noch nicht ganz entschieden: "The initiation of the free voluntary act appears to begin in the brain unconsciously, well before the person consciously knows he wants to act" (S.51). Später lässt er die Unentschiedenheit beiseite: "(T)he brain is preparing the purportedly 'free' actions significantly before the subject himself is aware that he intends to move. This temporal gap poses difficulty for the traditional concept of free will" (HAGGARD & LIBET, 2001, S.49). [17]
Es ist dieser "Libet's gap" (ebd.), welcher ROTH zu der Überzeugung führt, die Willensfreiheit sei experimentell falsifiziert und mithin eine Illusion, denn wenn, wie HAGGARD und LIBET (2001) es sagen: "preparatory brain activity causes our conscious intentions" (S.48), dann leben die Menschen gleichsam eine Art Rückspiegeldasein. Sie glauben zwar, sie blickten wie Autofahrer durch die Frontscheibe, um vorausschauend beispielsweise zu entscheiden, ob sie rechts abbiegen oder weiter geradeaus fahren, aber sie irren sich. Menschen können nur der Handlungswirklichkeit gewahr werden, deren neuronale Veranlassung bereits hinter ihnen liegt, die gleichsam im Rückspiegel erscheint. Und in diese projizieren sie dann im Nachhinein ihr Entscheiden und Wollen ("the subjective time of the stimulation is referred backward in time", LIBET, 2002, S.291). Die Süddeutsche Zeitung fasst diese Erkenntnis in folgende Überschrift: "Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun" (Nr.113, S.12). [18]
Nun ließe sich trefflich darüber streiten, ob die geschilderte Untersuchungsart solch weitreichende Interpretationen zulässt. Es ließen sich viele Fragen zur externen und zur internen Gültigkeit der Untersuchungsart stellen, und das ist inzwischen auch zuhauf geschehen (vgl. z.B. "Ein Fingerschnipsen ist keine Partnerwahl", WALDE, 2003, S.14). Begonnen hat dies bereits 1985 mit einem Diskussionsheft der Zeitschrift "Behavioral and Brain Sciences" (Bd. 8), eine weitere Erörterungsrunde erschien 2002 in der Zeitschrift "Consciousness and Cognition" (Bd. 11). Daneben gibt es zahllose Einzelartikel, die "Libet's gap" und seine Aussagekraft besprechen (vgl. z. B. HARTMANN, 2000; SEARLE, 2000). Im Blick auf all dies gesteht ROTH (2004a) zwar zu, dass die "sattsam diskutierten Experimente von LIBET" (S.133) möglicherweise "nur beschränkt aussagekräftige Laborexperimente" (ebd.) sind, doch hebt er die Beschränkung sogleich wieder auf, indem er fortfährt: "(S)ie fügen sich aber nahtlos in alle anderen psychologischen und neurowissenschaftlichen Erkenntnisse über 'willentliche' Handlungssteuerung ein" (ebd.), und diese besagen: Willensfreiheit gibt es nicht! Die vierte Kränkung der Menschheit ist also unausweichlich; sie ist empirisch-naturwissenschaftlich belegt. [19]
Es ist für meinen Argumentationszusammenhang, den ich hier ausbreiten will, nicht erforderlich, das argumentative Für und Wider und die Berechtigung von ROTHs summarischer Deutung der Aussagekraft der Experimente zu erörtern. Zum Zwecke des Argumentierens gehe ich vielmehr davon aus, dass die Experimente für sich genommen aussagekräftig sind. Dieses Vorgehen, fragwürdige Aussagen zum Zwecke des Argumentierens nicht zu hinterfragen, sondern fraglos hinzunehmen, um dann die Voraussetzungen, auf denen sie ruhen, und die Folgerungen, die sich daraus ergeben, zu erörtern, werde ich in diesem Text des Öfteren praktizieren. Daraus darf nicht gefolgert werden, dass ich die Fragwürdigkeit dieser Aussagen nicht für erörterungswert erachte, nur geht es mir hier um ein anderes Thema. Es geht um die "Frage nach der Existenz oder Nicht-Existenz von Willensfreiheit" (ROTH, 2004a, S.113) und um die Grundsätze ihrer Beantwortung. [20]
Wer Existenzfragen stellt, der muss sich über Existenzmöglichkeiten Gedanken machen. Damit bin ich beim Untertitel dieser Arbeit: "Möglichkeiten der psychologischen Vergegenständlichung von 'Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit'". [21]
Um das so umrissene Thema abzuhandeln, ist dreierlei zu leisten: Erstens, es ist zu klären, was mit "Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit" gemeint ist. Zweitens, es ist zu klären, welche Möglichkeiten einer psychologischen Vergegenständlichung sich ansetzen lassen. Und drittens, es ist zu klären, wie sich in diesen Vergegenständlichungsmöglichkeiten die "Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit" gegenständlich jeweils unterbringen lässt, zumindest hypothetisch, so dass die Existenzfrage gestellt werden kann. In dieser Reihenfolge geht es nun weiter. [22]
3. Erörterte Varianten der Willensfreiheit, vergleichende Betrachtung und Gemeinsamkeiten
Die Arbeit ist ganz im Sinne des neurowissenschaftlichen Zugangs objektwissenschaftlich angelegt. Es wird hypothetisch davon ausgegangen, dass es etwas gibt, und es wird gefragt, ob diese Existenz-Hypothese berechtigt ist. Das hier fragliche Etwas ist die Willensfreiheit. Um zu klären, was mit Willensfreiheit gemeint ist, stütze ich mich auf Aussagen von Neurowissenschaftlern und darauf, was uns unser aller alltagspraktisches Umgangswissen dazu sagt. [23]
Mit dieser Eingrenzung erspare ich es mir, das Thema in einen philosophischen Rahmen stellen zu müssen, in dem es seit zweieinhalb Jahrtausenden erörtert wird. Diese philosophischen Reflexionen kundig einzubeziehen, würde meinen Wissenshorizont überschreiten. Nur noch dunkel erinnere ich mich beispielsweise an die Selbstbetrachtungen des AUGUSTINUS und an den differenziert ausgebreiteten Zusammenhang zwischen göttlicher Allmacht, Willensfreiheit, Schuld und Sünde. Ich gehe auch nicht auf KANTs (1967) transzendentale Analysen der "Freiheit im kosmologischen Verstande" (S.561) und der "Freiheit im praktischen Verstande" (ebd.) ein, auch nicht auf HARTMANNs (1962) "Kritik der Kantischen Freiheitslehre" (S.686) ... und so weiter. All solche Reflexionen lasse ich hier "außen vor". [24]
Zunächst nehme ich eine Entdifferenzierung vor: In der Überschrift rede ich von der Dreiheit "Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit". Das unterlasse ich von nun an. Ich spreche nur noch von Willensfreiheit. Dies tue ich nicht, weil ich meine, die Begriffe ließen sich nicht unterscheiden. Ich tue es, weil die Neurowissenschaftler die Begriffe nicht trennen. Und mit ihnen möchte ich mich hier ja auseinandersetzen. Die meisten Neurowissenschaftler sprechen umfassend von Willensfreiheit und nennen die Debatte um sie die "Willensfreiheitsdebatte" (ROTH, 2004a). Schaut man sich die Bestimmungen der Willensfreiheit durch die Neurowissenschaftler an, so stellt man fest, dass sie die Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit sich wechselseitig bestimmen lassen. [25]
HAGGARD und LIBET (2001) bestimmen die Willensfreiheit so: "(W)e have conscious free will: that is, we have conscious intentions to perform specific acts, and those intentions can drive our bodily action, thus producing a desired change in the external world" (S.47). An anderer Stelle wird Willensfreiheit als "freely voluntary act" (LIBET u.a., 1983, S.623) spezifiziert. Und in der Untersuchung von 1985 sagt LIBET: "The subjects were free ... to choose to perform this act at any time the desire, urge, decision or will should arise in them" (S.530). SINGER (2000, S.44) verbindet die Willensfreiheit mit der Möglichkeit, zwischen verschiedenen Handlungen zu wählen ... und so ließe sich fortfahren. In all diesen Bestimmungen implizieren sich Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit wechselseitig. Ich schließe mich dieser entdifferenzierenden Redeweise hier an und spreche übergreifend von Willensfreiheit. [26]
So frage ich beispielsweise nicht, ob jemand, wenn er etwas trinken will, weil er durstig ist, wollen kann, dass er nicht trinken will, und ob man von ihm, falls ihm dies nicht gelingt, sagen muss, er sei nicht willensfrei. Solche Spitzfindigkeiten, die aus dem Begriff der Willensfreiheit herausgelesen werden können, lasse ich hier beiseite. Sie zu erörtern, trüge nicht zur Klärung der Frage, um die es hier vorrangig gehen soll, bei. [27]
Nun nehme ich eine Differenzierung vor: Unterhalb des begrifflich weiten Dachs der Willensfreiheit möchte ich insofern differenzieren als ich verschiedene Varianten derselben trenne. Ich unterscheide drei Varianten der Willensfreiheit: Spontaneitätswillensfreiheit, Unterbindungswillensfreiheit und Besinnungswillensfreiheit. [28]
3.1 Spontaneitätswillensfreiheit
Das ist die von LIBET inszenierte Willensfreiheit. Am Besten versteht man sie, wenn man sich LIBETs Instruktion, wie Menschen handeln sollen, die diese Freiheit praktizieren, anschaut. In der ursprünglichen Untersuchung (LIBET u.a., 1983) wurde den Versuchspersonen gesagt, sie sollten "freely and capriciously" handeln, das heißt das Handgelenk beugen. In der Untersuchung von 1985 erläutert LIBET die Instruktion so: "The subject ... is instructed to allow each such act to arise 'spontaneously' without deliberately planning or paying attention to the 'prospect' of acting in advance" (S.530). [29]
Dieser Erläuterung entlehne ich die Bezeichnung Spontaneitätswillensfreiheit. Das Libet-Experiment mag als paradigmatische Realisierung dieser Willensfreiheitsvariante gelten. Und wie LIBET meint belegt zu haben (obgleich er dies, wie er sagt, anfänglich gar nicht beabsichtigte), gibt es sie nicht. Er verwirft also die Existenz-Hypothese. [30]
3.2 Unterbindungswillensfreiheit
Diese Willensfreiheitsvariante ist, so meint LIBET, den Menschen gegeben. Sie besteht darin, einen aufkommenden Handlungsimpuls zu unterbinden, so dass die ihm gemäße Handlung nicht zur Ausführung gelangt. "(W)e have a conscious veto over the acts our brain has previously unconsciously prepared (so called 'free won't'), even if we lack conscious free will" (HAGGARD & LIBET, 2001, S.48). [31]
Aus der Existenz dieser Unterbindungswillensfreiheit leiten HAGGARD und LIBET übrigens Folgerungen ab, die in krassem Widerspruch zu dem stehen, was ROTH und SINGER in ihren massenmedialen Auftritten als Resultat der LIBETschen Untersuchungen verbreiten. Entgegen ROTH und SINGER verwerfen HAGGARD und LIBET (2001) die Verantwortungs- und Schuldkalküle in der Rechtsprechungspraxis nicht als wissenschaftlich haltlos, sie sagen vielmehr: "This brilliant revision of the traditional concept of free will saves most of its derivable corollaries, such as individual liberty and moral responsibility, while maintaining compatibility with modern neuroscience" (S.48). [32]
Die scholastische Frage: "Hätte Adam den Apfel, den ihm Eva darbot, verweigern können?" würde LIBET eindeutig bejahen. Er ist also schuldig und deshalb zu Recht des Paradieses verwiesen worden. [33]
Die Existenz dieser Unterbindungswillensfreiheit wird übrigens in der Rechtsprechungspraxis schon lange unterstellt. Ertappt beispielsweise ein Mann seine Ehefrau in flagranti mit einem Nebenbuhler im Bett und schlägt er daraufhin gleichsam unvermittelt zu, dann wird die Tat anders beurteilt, als wenn zwischen der Beobachtung der Untreue und der aggressiven Tat einige Zeit verstrichen ist. Im letzteren Fall hat er freiwillig gehandelt. Er hat freiwillig auf die Möglichkeit, den Handlungsimpuls zu unterbinden, verzichtet. [34]
Damit ist jene Freiheit gemeint, die wohl HUME (vgl. 1955) meinte, als er sagte, auf ihr gründe unsere zwischenmenschliche Lebensführung, zumindest in wichtigen Lebensbezügen. Beispiele für das Praktizieren dieser Freiheit mögen wichtige Marken des Lebenswegs eines jungen Mannes sein: Wehrdienst verweigern, Studienfach aussuchen, Wahl eines Berufs, Heirat eines Lebenspartners, Eintreten in eine politische Partei, Kauf eines Hauses und dergleichen existenzielle Entscheidungen und Handlungen mehr. Es ist die Besinnungswillensfreiheit, die Menschen schlaflose Nächte bereiten kann. Es lohnt sich, den Implikationsgehalt dieser Willensfreiheit zu explizieren. Was denken Menschen in ihrem alltäglichen Lebensvollzug mit, wenn sie sich oder einem Mitmenschen Besinnungswillensfreiheit unterstellen? [35]
Besinnungspotenzial: Die Besinnungsfreiheit setzt ein Potenzial voraus, von dem manche philosophischen und biologischen Anthropologen meinen, es unterscheide den Menschen vom Tier (vgl. z.B. PLESSNER, 1980-83). Menschen können in ihrem Handlungsstrom innehalten, aus diesem gleichsam heraustreten, um die Lebenssituation, in der sie sich befinden, so zu vergegenständlichen, dass sie diese nach Maßgabe irgendwelcher Gesichtspunkte durchdenken können: In welcher Lage befinde ich mich? Was mache ich hier eigentlich? Wie stelle ich mich dazu? Das ist mit Besinnen gemeint – alternativ ließe sich von Reflektieren, von Sich-bewusst-Machen, von Nachdenken, von Bedenken reden. Die Vorschläge, die antike griechische und römische Philosophen den Menschen machen, damit sie sich von üblen Gedanken, Launen und Gefühlen heilen können, basieren alle ausdrücklich auf diesem Besinnungspotenzial (vgl. HADOT, 1991; LAUCKEN, 1994). [36]
Offener Möglichkeitshorizont: Mit solchem Besinnen betreten Menschen aber erst den Raum möglicher Freiheit. Erst wenn das Besinnen zu dem Ergebnis führt, ein Mensch könne sich entscheiden, so oder so zu handeln oder es zu unterlassen, erfährt ein Mensch sich als frei. Zur Besinnungswillensfreiheit gehört ein (mehr oder weniger) offener Möglichkeitshorizont. [37]
Eigene Einsicht: Welcher Beschaffenheit dieser Möglichkeitshorizont ist, das zu wissen, muss eigener Einsicht entsprungen sein. Eine Lebenslage, in der ein Mensch zwar weiß, er könne dies oder das tun, in der er aber aus mangelnden Gründen nicht weiß, warum sich ihm diese Möglichkeiten bieten und welche Folgen die jeweiligen Realisierungen nach sich ziehen, ist keine Situation, in der sich ein Menschen als besinnungswillensfrei erfährt. Besinnungswillenfreiheit setzt selbständiges Denken und Einsehen voraus (natürlich können einem Menschen diese Einsichten von Mitmenschen vermittelt werden) und sie setzt auch ausreichend Zeit, dieses vollziehen zu können, voraus. [38]
Erträgliche Folgen: Aber selbst dann, wenn die Handlungsmöglichkeiten eigenem Einsehen entsprungen sind, erfahren sich Menschen dann nicht als besinnungswillensfrei, wenn alle Alternativen bis auf eine mit unerträglichen Folgen verbunden sind. Zum Erfahren von Besinnungswillensfreiheit gehört, dass die voraussichtlichen Folgen einzelner Handlungsmöglichkeiten als erträglich eingeschätzt werden. In diesen Einschätzungen werden Menschen sich sicherlich unterscheiden, so dass eine Situation von einem Menschen als willensfrei, von einem anderen als zwanghaft erfahren werden kann. [39]
Unsicherheitsbelastet: Die abgesehenen Folgen verschiedener Handlungen sind stets voraussichtlicher Natur. Zur Besinnungswillensfreiheit gehört in der Regel, dass die Entscheidung für eine Handlungsmöglichkeit unsicherheitsbelastet ist. Zwar hat ein Mensch bestimmte Erwartungen, an denen er sich ausrichtet, doch bleibt stets die Sorge, es könne auch anders kommen. [40]
Selbstbestimmt: Ein Mensch erfährt sich schließlich erst dann als willensfrei, wenn er sich als die Instanz erfährt, die in dem dargelegten Einschätzungs- und Urteilszusammenhang für sich festlegt, welche Handlung sie vollzieht. Erst dann erfährt er sich als jemanden, der für sein Handeln zuständig ist. [41]
Fasst man diesen Explikationsbefund zusammen, so kann man sagen: Als willensfrei im Sinne der Besinnungswillensfreiheit erfährt ein Mensch sich und sein Handeln, wenn Folgendes gilt: In einer bestimmten Situation führt ein Mensch A eine Handlung X aus, weil er dafür gute Gründe hat. Diese hat er aus eigener Einsicht gewonnen (oder er hat sie sich zueigen gemacht). Wenn A sich entschieden hätte, nicht die Handlung X sondern die Handlung Y auszuführen, so hätte er nicht unerträgliche Folgen befürchten müssen. Zwar hofft A, dass das Tun von X bestimmte Folgen haben wird, doch kann er sich dessen nicht ganz sicher sein. All diese Erkenntnisse ergaben sich für A aus der (reflexiven) Besinnung seiner Situation. Die daraus resultierende Handlung schreibt er sich als Besinnungs- und Vollzugsinstanz zu. [42]
Es ist leicht ersichtlich, dass die Besinnungswillensfreiheit mit LIBETs Spontaneitätswillensfreiheit nichts zu tun hat. Man könnte fast sagen, diese ist das Gegenteil von jener, zumindest dann, wenn die Versuchspersonen sich so verhielten, wie LIBET (1985) sie instruierte, sich zu verhalten: "(W)ithout deliberately planning or paying attention to the 'prospect' of acting in advance" (S.530). Das Libet-Experiment ist also ausdrücklich keine experimentelle Realisation der Besinnungswillensfreiheit, sondern es ist die Realisierung einer Willensfreiheit, die, so vermute ich, die meisten Menschen in ihrem alltäglichen Lebensvollzug wohl kaum als einen relevanten Fall von Willensfreiheit betrachten würden. Ich will mich durch diese Relevanzeinschätzung jedoch nicht davon abhalten lassen, die Spontaneitätswillensfreiheit weiterhin als eine denkbare Variante der Willensfreiheit im Blick zu behalten. Ich greife also nicht Kritiken an LIBETs Experiment auf, die besagen, dass das, was er untersucht habe, gar nichts mit Willensfreiheit zu tun habe bzw. dass es eine lebenspraktisch ziemlich irrelevante Variante darstelle. [43]
Eines sollte damit klar sein. Sollte LIBET (aus welchen Gründen auch immer) Recht haben, dass es die Spontaneitätswillensfreiheit nicht gibt, dann sagt deren Inexistenz noch nichts über die Existenz der Besinnungswillensfreiheit aus. – Aber auch diese Folgerung soll hier nicht weiter thematisiert werden. [44]
|
Ergänzung WEGNER (2002) beschreitet mit seiner "Illusion of conscious will" (Titel) einen argumentativen Weg, welcher der Betrachtung wert ist. WEGNER folgert diese Willens-Illusion daraus, dass Menschen manchmal (oder häufig) etwas tun, von dem sie im Nachhinein meinen, sie hätten es freiwillig getan, obgleich sie sich darin täuschen. Durch raffinierte experimentelle Inszenierungen (z.B. die "I spy"-Inszenierung) gelang es ihm, Versuchspersonen dieser Selbsttäuschung zu überführen. Gesetzt den Fall, die experimentellen Befunde sind valide, so ergibt sich daraus gleichwohl nicht, dass es keinen bewussten Willen und mithin keine Willensfreiheit gibt. Es ergibt sich daraus lediglich, dass es durch geschickte Manipulationen gelingen kann, Menschen zu suggerieren, sie seien Urheber bestimmter Taten, obgleich sie es nicht sind (man denke hier auch an die immer wieder argumentativ bemühten "posthypnotischen Handlungen"). WEGNERs Befunde sind interessante Befunde, doch aus ihnen lässt sich keine Widerlegung der Möglichkeit bewussten Wollens ableiten. So ist ja auch die Möglichkeit optischer Täuschungen kein Beleg dafür, dass es kein veridikales visuelles Wahrnehmen geben kann. Und ein Weiteres sei hier ergänzend vermerkt: Es ist beispielsweise für einen Handlungstheoretiker kein Problem, Handlungen so weit zu fraktionieren/zu zerlegen (z.B. einschlusshierarchisch gemäß dem TOTE-Modell von MILLER, GALANTER & PRIBRAM, 1960), dass niemand mehr auf die Idee kommt, für das gewöhnlich Vollziehen solcher aktionalen Zerlegungseinheiten (z.B. eine Vorwärtsbewegung des rechten Fußes beim Laufen zum Briefkasten) Willensfreiheit zu reklamieren. Daraus ergibt sich aber nicht, dass dann auch einschlusshierarchisch umfassendere Handlungen nicht willensfrei vollzogen werden. So ist es offensichtlicher Unsinn, zu sagen, dass die Studienfachwahl eines Studierenden deswegen nicht besinnungswillensfrei vollzogen worden sein, weil er "unbewusst" oder "automatisiert" (also nicht willensfrei) seine Bewebungsunterlagen mit der linken Hand in den Briefkasten geworfen hat. [45] |
3.4 Gemeinsame Bestimmungsmomente der drei Varianten der Willensfreiheit
Keinesfalls soll die Unterscheidung der drei Varianten suggerieren, damit sei der Variantenspielraum erschöpft. Die Auswahl der drei Varianten folgt hier konkret thematischen Überlegungen: die Spontaneitäts- und die Unterbindungswillensfreiheit werden von LIBET eingeführt (auch wenn er sie so nicht nennt) und die Besinnungswillensfreiheit soll hier als ein Kontrast, der die bemerkenswerte Besonderheit vor allem der Spontaneitätswillensfreiheit klar hervortreten lässt, dienen. [46]
Über alle Unterschiede hinweg sind aber allen drei Varianten der Willensfreiheit einige Bestimmungsmomente gemeinsam. Sie sind für alle drei Varianten der Willenfreiheit konstitutiv. Denkt man sich eines dieser Momente weg, so macht es keinen Sinn mehr, von Willensfreiheit (gleichgültig, ob sie illusionär oder real ist) zu reden, weil dann das, was damit gemeint ist, verschwunden wäre. [47]
Es wird im Übrigen nicht der Anspruch erhoben, dass die im Folgenden explizierten Bestimmungsmomente das Spektrum gemeinsamer Momente erschöpfen, sie werden hier herausgegriffen, weil sie bei nachfolgenden Erörterungen wieder aufgegriffen werden. [48]
Ich-Bezug: Die im Lebensvollzug von Menschen erfahrene Willensfreiheit setzt stets eine Instanz voraus, die sich als ein Ich, das handelnd zu fungieren vermag, begreift. Sehr deutlich tritt dieser Ich-Bezug bei der Besinnungswillensfreiheit hervor. Hier taucht das Ich gleichsam doppelt auf, als besinnende Vollzugs- und als besonnene Gegenstandsinstanz. Doch auch bei den beiden anderen Willensfreiheitsvarianten wird er vorausgesetzt. Bei der Spontaneitätswillensfreiheit erkennt man dies bereits an der Instruktion, die LIBET seinen Versuchspersonen gibt. Die Versuchspersonen werden angesprochen als Personen, die als Handlungsinstanzen fungieren können. Und bei der Unterbindungswillensfreiheit taucht bei LIBET das Ich sogar als moralische Instanz auf, die nein sagen kann. Allgemein gesagt: Eine Person erfährt sich potenziell als frei, wenn sie von sich sagen kann: "Ich bin es, die da handelt". Es gibt kein Freisein ohne personalen Ich-Bezug. [49]
SEARLE (2000) spricht in vergleichbaren Argumentationszusammenhängen davon, dass ein "Selbst" postuliert werden müsse ("postulation of a self", S.16). Der Phänomenologe Edmund HUSSERL (1954) spricht von einem (transzendentalphänomenologisch geforderten) "leistend-fungierenden Ich". [50]
|
Ergänzung In diesem Ich-Bezug steckt auch nicht der Hauch einer Homunculus-Unterstellung (oder eines "Geists in der Maschine", RYLE, 1949), auch die Annahme eines irgendwo außerhirnlich hausenden "zentralistischen Dirigenten" (so SINGER in der F.A.Z vom 8. 1. 2004) ist hier gänzlich abwegig. Der Ich-Bezug expliziert lediglich eine Implikation des Begriffs der Willensfreiheit. Dächte man sich diese Implikation weg, dann ergäbe es keinen Sinn mehr, von Willensfreiheit zu sprechen. [51] |
Intentionale Gebundenheit: Es widerspricht dem lebenspraktischen Erfahren von Willensfreiheit, sie so zu bestimmen, als erfordere sie gleichsam das Vorhandensein eines kausalen Nullpunkts. Für alle hier vorgestellten Willensfreiheiten gilt, dass ihre Vollzugsrealisierung nicht voraussetzt, dass sich in ihr ein unbedingter Bedinger Bahn bricht (wie ROTH, 2004a, zu meinen scheint). Niemand würde sein Handeln als willensfrei erfahren, wenn es unbedingt aus ihm herausbräche, so dass er nicht in der Lage wäre, Gründe anzugeben. Wem dies geschähe, der würde an sich das Gegenteil von Willensfreiheit erfahren. Folgerichtig wurde von LIBET u.a. (1983) der "freely voluntary act" (S.623) als instruierbar angesehen: Die Versuchspersonen sind gebeten worden, an einer Untersuchung teilzunehmen. Sie erklären sich bereit. Und nun sitzen sie da und hören sich an, was sie gleich machen sollten. Sie sollen, so sagt man ihnen, eine besondere Intention bilden, die Intention "spontan" zu handeln. Das tun sie sodann und sie erfahren sich dabei als ein personales Ich, das die Intention, spontan zu handeln, realisiert. Ihr willensfreies Handeln ist also intentional gebunden. Menschen erfahren sich mithin als willensfrei, wenn ihr Handeln ihren Intentionen entspricht und wenn die Intentionen sich aus ihren Überlegungen ergeben. Allgemein gilt: "When thought seems to cause action, we experience will" (WEGNER & ERSKINE, 2003, 685). Ein Verhalten, das denk- und intentionsfrei plötzlich aus uns hervorbricht, wäre der Gipfel erlebter Unfreiheit. So etwas kann mit "spontan" (die lexikalische Bedeutung ist nicht ganz eindeutig) nicht gemeint sein, auch nicht von LIBET, denn sonst ließe sich die Spontaneitätsintention ja nicht derart instruieren, wie er es getan hat. Kausale Nullpunkte lassen sich nicht instruieren. Die Annahme, dies sei möglich, wäre in sich widersprüchlich. [52]
Inferenzielle Einbettung: Dies ist eine Erweiterung des Moments der intentionalen Gebundenheit. Die Einbettung der Willensfreiheit, gleich welcher Variante, in den irgendwie artikulierten Aktivitätsstrom einer Person ist für diese inferenzieller Art. Die einzelnen Glieder sind untereinander inhaltlich folgerichtig geordnet. Ein Beispiel: Gesetzt den Fall, es läge folgender Zusammenhang vor "... Überlegen, Unterscheiden, Vergleichen, Abwägen, Entscheiden, Beschließen, Wollen, Handeln ("freely voluntary act"), Ergebnis, Folgen ...", dann sind diese einzelnen Abschnitte untereinander nicht zufällig oder willkürlich geordnet, sondern sie gehorchen einer klaren inferenziellen Ordnung. Nur in dieser Ordnung hat der "freely voluntary act" seinen Ort um als eben solcher Akt fungieren zu können (man kann ihn nicht vorziehen und beispielsweise zwischen Überlegen und Unterscheiden platzieren oder hinausschieben und zwischen Ergebnis und Folgen unterbringen). [53]
Das mag an explizierenden Überlegungen zur Willensfreiheit genügen. Die nächsten Schritte meiner Darlegungen zielen darauf ab, die explizierten Varianten der Willensfreiheit, vor allem ihre gemeinsamen Bestimmungsmomente daraufhin zu befragen, wie sie sich psychologisch vergegenständlichen lassen, so dass die "Frage nach der Existenz oder Nicht-Existenz von Willensfreiheit" (ROTH, 2004a, S.133) gestellt und beantwortet werden kann. [54]
|
Ergänzung Auf eine Frage, die manchem an dieser Stelle in den Sinn kommen könnte, möchte ich hier noch eingehen. Ich habe das, was mit Willensfreiheit angesprochen wird, zu explizieren versucht. Warum, so mag sich manch einer fragen, liefere ich nicht eine knappe und klare Definition und erspare mir so die Mühen des Explizierens, zumal das Explizieren stets unschärfer ist als das Definieren? Ich will mit einer Gegenfrage antworten. Was wäre damit gewonnen, wenn ich hier eine Definition der Willensfreiheit vorlegte, die zwar knapp und bündig wäre, die aber als solche im Lebensvollzug konkreter Menschen nicht vorkäme? Die "Willensfreiheitsdebatte" (ROTH, 2004a) ist deshalb so spannend und auch öffentlichkeitswirksam, weil in ihr eine Größe thematisiert wird, die Menschen in ihrem alltäglichen Lebensvollzug zu leben vermeinen. Diese lebenspraktische Willensfreiheit erörtern die Neurowissenschaftler und sie ist es, die von manchen zur Illusion erklärt wird. Deshalb muss man sich um sie kümmern und dem dient ihre Explikation. [55] |
Bevor ich ROTHs "Existenzfrage" aufgreifen kann, muss ich etwas Vorgängiges leisten. Ich muss über denkbare Existenzmöglichkeiten nachdenken. Dies tue ich, indem ich drei psychologische Denkformen vorstelle, die sich untereinander durch die ihnen jeweils zugrunde liegenden Gegenstandsentwürfe unterscheiden. Sind diese Gegenstandsentwürfe im folgenden Abschnitt dargelegt, so lässt sich im darauf folgenden Abschnitt jeweils auf sie bezogen die "Existenzfrage" präzise stellen und beantworten. [56]
In dem nun folgenden Abschnitt taucht die Willensfreiheit als thematische Größe direkt nicht auf. Er liefert jedoch notwendige Denkvoraussetzungen. Man muss diesem Abschnitt einige Geduld widmen, weil von seiner Qualität die Qualität der Beantwortung der "Existenzfrage" abhängt. [57]
4. Psychologische Denkformen, ihre Gegenstandsentwürfe und Ermöglichungsbeziehungen
Dieser Abschnitt ließe sich unter ein Motto stellen, das der Philosoph Ernst CASSIRER (1996) so formuliert: "Die Schaffung einer kohärenten, systematischen Terminologie ist keineswegs ein nebensächliches Unterfangen; sie ist ein wesentlicher und unverzichtbarer Teil von Wissenschaft" (S.318). Und: "Jedes (terminologische) System ist ein 'Kunstwerk' – Ergebnis eines bewussten, schöpferischen Aktes" (S.319). So ist etwa, wie CASSIRER (1980) an anderer Stelle darlegt, "(d)ie Auffassung des Kosmos als ein System von Körpern und die Auffassung des Geschehens als eine Wirkung physikalischer Kräfte erst spät hervorgetreten; wir können sie kaum weiter verfolgen als bis in das 17. Jahrhundert" (S.46). Auch der Kosmos der Naturwissenschaften ist ein "Kunstwerk". "Bei DESCARTES begegnen wir erstmals dem Gedanken eines streng mathematischen und mechanischen Universums" (ebd.). [58]
Mit diesen Hinweisen soll nicht gesagt werden, dass die in diesem Abschnitt vorgetragene Systematisierungsarbeit Ergebnis imaginativen Beliebens sei, das sich vielleicht nur ästhetisch bewerten lässt. Die Systematisierungsarbeit ist vielmehr Teil eines Unterfangens, dem es darum geht, theoretische und praktische Probleme zu lösen. An dieser Problemlösungseignung ist seine Güte zu bemessen. So geschah und geschieht es auch bei der Beurteilung der Güte des naturwissenschaftlichen Gegenstandsentwurfs (zu dem ich bald kommen werde). [59]
Es werden in diesem Abschnitt drei psychologische Denkformen vorgestellt (ausführlich in LAUCKEN, 2003a). Jede Denkform zeichnet sich durch einen nur ihr eigenen Gegenstandsentwurf aus: Das gibt es! Das kann erforscht werden! Dieser Gegenstandsentwurf ist konstitutiver Teil der inwendigen Architektur einer Denkform. [60]
Die inwendige Architektur eines Gedankengebäudes lässt sich nie allein aus sich heraus begründen. Immer gibt es irgendwelche Setzungen, die das Fundament ausmachen, welches nicht aus sich heraus begründet werden kann. Diese Setzungen kann man natürlich bezweifeln oder sie sogar ablehnen (etwa weil sich in ihnen der Sündenfall eines dualen Welterschließens offenbart – wo doch alles nur eins ist). Lehnt man bestimmte Setzungen ab, dann verliert natürlich das Gedankengebäude, dessen Fundament sie sind, seinen Halt. Für die Erörterung eines Gedankengebäudes ist es deshalb wichtig, dass sich die Disputanten auf einen Satz einvernehmlicher Setzungen einigen. Eine Disputation wird sumpfig und beliebig, wenn man das Fundament, auf dem man argumentativ steht, ständig ändert, je nach aktuellem Gebrauchsbelieben. [61]
4.1 Basissemantische Differenzen wissenschaftlichen Erkennens
Jedes wissenschaftliche Erkenntnisunternehmen geht davon aus, dass das Erkennen eine vierstellige Relation ist, deren Prozessieren einer regulativen Leitidee untersteht: Die Leitidee ist die der Wahrheit (diese kann unterschiedlich gefasst sein, z.B.: repräsentationistisch, instrumentalistisch, falsifikationistisch oder irgendwie "symbiotisch kombiniert"; CACIOPPO, SEMIN & BERTSON, 2004) und die vier Stellen der Erkenntnisrelation sind: Erkenntnisobjekt, Erkenntnissubjekt, Erkenntnismittel und Erkenntnisergebnis. [62]
Ein jeder, der einen Forschungsantrag bei der DFG stellt, akzeptiert diese Differenzen. Sie machen das grundlegende Ordnungsraster jedes Erkenntnisunternehmens aus. Die einzelnen Leerstellen dieses Rasters schließen sich wechselseitig aus (vgl. SCHRÖDINGERs "Ausschließungsprinzip", 1989, S.66). Es gibt demnach ein Erkenntnisobjekt, welches nicht zugleich das Erkenntnissubjekt sein kann. Und es gibt Erkenntnismittel und Erkenntnisergebnisse, welche nicht zugleich Teil des Erkenntnisobjekts sind und so weiter. [63]
Diese wechselseitigen Ausschließungen sind erkenntnissemantisch konstitutiv. Sonst landet man in einer "Hölle unerträglicher Antinomien" (SCHRÖDINGER, 1989, S.59). So besteht das "Eröffnungsgambit" (ebd., S.61; Gambit: Zug zur Eröffnung des Schachspiels, bei dem meist ein Bauer geopfert wird) jedes Wissenschaftsspiels in der klaren Trennung zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt. SCHRÖDINGER erblickt darin einen "Preis" (ebd.), den der Wissenschaftler zu zahlen hat, um am Wissenschaftsspiel teilnehmen zu können. [64]
Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, davon auszugehen (und ich gehe davon aus), dass ein Erkenntnisobjekt nur relativ zu einem Erkenntnissubjekt erkannt werden kann. Dies gilt nicht nur für Naturwissenschaftler, die SCHRÖDINGER vor Augen hatte. Dies gilt auch für die hermeneutischen Wissenschaftler. Auch der Hermeneutiker geht davon aus, dass jeder Wissenschaftler, der sich einem bestimmten Gegenstand (z.B. einem Text) in methodisch und inhaltlich bestimmter Weise zuwendet, zu Erkenntnisergebnissen kommt, die von den gegenständlichen Eigenarten des Erkenntnisobjekts abhängen. Zu unterschiedlichen Platon-Interpretationen etwa sagt CASSIRER (1996): "Jede von ihnen hat einen Aspekt erhellt, der in diesem Werk zwar enthalten ist, aber nur durch einen komplexen Denkprozess manifest werden kann" (S.276). Wäre eine hermeneutische Erkenntnis eines Werks nicht durch etwas, das in dem Werk objektiv enthalten ist, belegt, so verlöre die Erkenntnis ihren Erkenntnisstatus. [65]
Betrachtet man die vier Stellen der Erkenntnisrelation als Leerstellen, die jeweils untersuchungsspezifisch ausgefüllt werden können, dann sind die psychologischen Denkformen, um die es nun gehen wird, unterschiedliche und jeweils in sich stimmige Ausfüllungen der Leerstellen. Im Verweisungszentrum einer jeden Denkform steht die Eigenart des Erkenntnisobjekts. Ich werde im Weiteren von dem jeweiligen Gegenstandsentwurf und seinem Realitätsmodus (oder Gegenstandsmodus) reden. [66]
Die verweisungszentrale Rolle, die die Eigenart des Gegenstandsentwurfs für das Verständnis eines Erkenntnisunternehmens spielt, betont CASSIRER (1996), indem er erläutert, dass beispielsweise die Unterschiede zwischen den Geschichts- und Naturwissenschaften in deren unterschiedlichen "Objekten" liegen und nicht, wie häufig angenommen, in unterschiedlichen Logiken des Forschens: "Bei der Suche nach Wahrheit ist der Historiker an ... formale Regeln genauso gebunden wie der Naturwissenschaftler. In der Art und Weise, wie er reflektiert und argumentiert, bei seinen induktiven Schlüssen, bei der Erkundung der Ursachen gehorcht er den gleichen allgemeinen Denkgesetzen wie der Physiker oder der Biologe. Soweit es um diese elementaren Tätigkeiten des menschlichen Geistes geht, können wir keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Erkenntnisbereichen treffen" (S.269). Es ist nicht die grundlegende/elementare Erkenntnislogik, die die historischen von den Naturwissenschaften trennt, sondern es sind vorrangig die unterschiedlichen Realitätsmodi ihrer Gegenstände, die sodann nach besonderen Forschungsmethoden verlangen und unterschiedliche Forschungsziele nahe legen. [67]
Damit die Erläuterungen nicht zu abstrakt geraten, will ich ein psychologisches Beispiel vorausschicken, das Plausibilitätsmaterial liefern soll. [68]
4.2 Ein Beispiel unterschiedlicher Vergegenständlichungen
Man stelle sich vor, ein Klient suche einen Psychotherapeuten auf, weil er unter Ängsten leidet. Was wird aus dem Klienten und seinen Ängsten, abhängig davon, ob er einen neuropsychologisch, einen kognitionstheoretisch oder einen daseinsanalytisch ausgerichteten Psychologen aufsucht? Je nachdem, wem der Klient gegenübersitzt, wird aus ihm und seinen Ängsten etwas recht Unterschiedliches. [69]
Der Neuropsychologe vergegenständlicht den Klienten als ein Gefüge neuronaler Zustände und Vorgänge, die sich in bestimmten anatomischen Strukturen abspielen. Die Ängste, von denen der Klient berichtet, sind Begleiterscheinungen bestimmter elektrochemischer Vorgänge in bestimmten Regionen des Gehirns. [70]
Der kognitionstheoretisch orientierte Psychologe vergegenständlicht den Klienten als ein Bedeutungen prozessierendes Wesen. Er lebt in einer bedeutungshaltigen Welt. Er verarbeitet Bedeutungsgehalte. Er erstellt neue und er handelt bedeutungshaltig. Die vom Klienten geschilderten Ängste verweisen auf Emotionen. Diese gelten als Bedeutungsgrößen, die sich aus bestimmten Einschätzungen und Bewertungen ergeben und die zu bestimmten Handlungen führen. [71]
Der Daseinsanalytiker vergegenständlicht seinen Klienten als jemanden, der sich als in besonderer Weise in der Welt seiend erlebt. Das Leben eines Menschen, so setzt der Daseinsanalytiker gegenständlich, ist ein Kosmos erlebten Lebens, der in sich narrativ gefügt ist. Die geschilderten Ängste weisen den Daseinsanalytiker auf Gefühle hin, die stimmige Momente bestimmter Weisen des erlebend-gelebten In-der-Welt-Seins sind. [72]
Je nachdem, welchem Psychologen der Klient gegenübersitzt, wird aus ihm, nun wähle ich abstrahierende Worte, ein physischer Zusammenhang, ein semantischer Zusammenhang oder ein phänomenaler. Die geschilderten Ängste dienen einmal als Hinweise auf bestimmte neuronale Zustände und Vorgänge, andermal als Hinweise auf bestimmte Einschätzungen und Bewertungen und schließlich als Hinweise auf bestimmte Momente narrativer Ordnungen erlebten Daseins. [73]
Abhängig von dem Realitätsmodus der Vergegenständlichung variieren nicht nur die Hinweisqualitäten der geschilderten Ängste, sondern auch die Behandlungspraxen. Der Neuropsychologe wird in neuronale Stoffwechselvorgänge therapeutisch eingreifen, der Kognitionspsychologe in semantische Verarbeitungsprozesse und der Daseinsanalytiker wird den Klienten anhalten, seinem Leben eine veränderte narrative Ordnung zu geben. [74]
Die hier exemplarisch plausibel gemachten Varianten psychologischer Vergegenständlichung sollen nun der Reihe nach gründlicher vorgestellt werden. Dies ist notwendig, um danach fragen zu können, wie sich denn die Willensfreiheit in dem jeweiligen Gegenstandsmodus unterbringen lässt, um die "Existenzfrage" stellen und beantworten zu können. [75]
4.3 Physische Denkform und ihr Gegenstandsmodus
Jedes Forschen, ich sprach davon, muss, bevor es beginnen kann, sich darüber Klarheit verschaffen, welchem Gegenstandsmodus sein besonderer Forschungsgegenstand zugehört. Der Gegenstandsentwurf der gesamten klassischen Naturwissenschaften ist der physische Kosmos. Seine Setzung "beruht auf Akten theoretischer Vergegenständlichung, der Objektivierung durch Konzepte und wissenschaftliche Konstrukte" (CASSIRER, 1996, S.246). Für ihn gelten, abstrakt formuliert, folgende "Es gibt"-Behauptungen:
Es gibt eine physische Realität. Es gibt Masse und Energie. Es gibt Einheiten derselben. Diese sind in einem physischen Raum verteilt. Veränderungen der Verteilung sind zeitlich erstreckt und bedingungskausal bewirkt. In ihren Wirkbeziehungen ist die physische Realität kausal geschlossen. [76]
Die grundlegenden Existenz-Dimensionen der physischen Realität sind die Dimensionen: Raum, Masse bzw. Energie und Zeit. In einem klassischen Lehrbuch zur physikalischen Dynamik von RAMSEY (1954) wird demnach darauf hingewiesen, dass man bei physikalischen Gleichungen darauf achten müsse, dass sich auf beiden Seiten einer Gleichung Größen gleicher Dimensionalität befinden, denn "each side of the equation must represent the same physical thing and therefore must be of the same dimensions in mass, space and time" (S.42). Und der Teilchenphysiker GREEN (2004) sagt in einem Interview: "Alles was wir kennen (ist) – Raum, Zeit, Materie, Energie" (S.192). [77]
Dieser Realitätsentwurf lässt sich natürlich vielfältig spezifizieren: mikro-, meso- und makrophysikalisch. Eine denkbare Spezifizierung ist die neurowissenschaftliche Analyse des Gehirns. Sie richtet die Aufmerksamkeit "to patterns in the space of the brain" (BEAULIEU, 2003, S.562). So wurde kürzlich (im Jahre 2003) die finnische Neurowissenschaftlerin Riita HARI mit dem Schweizer Louis-Jeantet Preis ausgezeichnet, für die besonders genaue Erfassung und Erforschung räumlicher und zeitlicher Aktivierungssequenzen im menschlichen Gehirn. [78]
Aussagen über die physische Realität, also Erkenntnisergebnisse, lassen sich letztlich immer zurückführen auf "cm, g, sec"-Aussagen. Das heißt, hinsichtlich jeder beliebigen Einheit X des physischen Kosmos, egal auf welcher Auflösungsstufe und egal in welcher Spezifizierung, sind folgende Fragen zulässig: Wie groß ist X? Wie schwer ist X? In welcher zeitlichen Erstreckung existiert X? – und darauf aufbauend: Welche elektrische Ladung hat X? Welche z.B. kinetische Energie ist ihm eigen? ... und so weiter. [79]
Aus dieser charakteristischen Eigenart des Gegenstandsmodus der physikalischen Denkform lässt sich eine einfache und gedanklich gut handhabbare Zugehörigkeitsprobe ableiten: Stellt sich jemand die Frage, ob eine Einheit X eine Größe ist, die zum Gegenstandsmodus der physischen Denkform gehört, dann frage er sich einfach, ob es sinnvoll ist, auf sie bezogen "cm, g, sec"-Fragen zu stellen. Ein Beispiel: Ist X ein Molekül, das im synaptischen Spalt entdeckt worden ist, so ist es sinnvoll, z.B. nach dessen elektrischer Ladung zu fragen. Also, das Molekül gehört zum physischen Kosmos. Ist ein X dagegen ein Gefühl, etwa das Erleben von Eifersucht, so macht es keinen Sinn nach dessen elektrischer Ladung zu fragen. Also, das Gefühl der Eifersucht als Erlebenstatbestand ist kein Gegenstand der physischen Realität. [80]
Mit dieser Zugehörigkeitsprobe kann man spannende Entdeckungen machen. Darauf hat der schon erwähnte Physiker (und Nobelpreisträger) Erwin SCHRÖDINGER (1989) hingewiesen: "Die materielle Welt (d.h. der Gegenstandsmodus der physischen Denkform; U.L.) konnte bloß konstituiert werden um den Preis, dass das Selbst, der Geist, daraus entfernt wurde. Der Geist (mind, mens) gehört also nicht dazu und kann darum selbstverständlich die materielle Welt weder beeinflussen noch von ihr beeinflusst werden" (S.60). Dieses "Entfernen" ist grundlegend für den physischen Gegenstandsentwurf. "(D)er Welt der Naturwissenschaften (mangelt folglich) alles, was Bedeutung ... hat" (S.96). Es fehlt ihr aber nicht nur, es kann sogar "von einem rein naturwissenschaftlichen Standpunkt überhaupt nicht organisch eingebaut werden" (ebd.). [81]
Daraus ergibt sich die bemerkenswerte Tatsache, dass die Erkenntnisergebnisse der Naturwissenschaften im Kosmos der Naturwissenschaften nicht vorkommen. Im physischen Kosmos gibt es sie nicht. Es macht nämlich keinen Sinn, zu fragen, welche Masse beispielsweise dem van't Hoffschen Gesetz zukommt. Aber nicht nur die Erkenntnisergebnisse finden im physischen Kosmos keinen Platz, auch die empirischen Daten, also das wichtigste Erkenntnismittel, sind physisch inexistent, denn er ergibt keinen Sinn, beispielsweise nach der elektrischen Ladung der Daten zu fragen, die ein bildgebendes Verfahren liefert. [82]
Diese bemerkenswerte Tatsache macht die physische Denkform aber nicht zu einem in sich inkonsistenten Erkenntnisunternehmen. Dafür sorgen die oben explizierten säuberlichen Trennungen zwischen den Leerstellen der vierstelligen Erkenntnisrelation. Es stört die Stimmigkeit der physischen Denkform mithin nicht, wenn die Physik als wissenschaftliche Disziplin im physischen Kosmos gegenständlich nicht unterzubringen ist. Allerdings sollte diese Einsicht überheblichen Allerfassungsansprüchen den Boden entziehen. [83]
|
Ergänzung Freilich kann diese Einsicht die Naturwissenschaftler auch vor unfairen Selbstanwendungsargumenten schützen: "Da gibt es drei Gehirne, die seit drei Monaten die Feuilletons beschäftigen und auf akustische Stimulation hin, die die Laien 'Frage' nennen, die Namen 'Wolf Singer', 'Gerhard Roth und 'Wolfgang Prinz' verlauten lassen. Sie veranlassen den Rest ihres Körpers dazu, Neurowissenschaft zu betreiben ..." (SCHNÄDELBACH, 2004). Der so genannte performative Selbstwiderspruch ist durch die basissemantischen Differenzen aufgehoben. Natürlich ist dies SCHNÄDELBACH bekannt. Er sieht in der Selbstanwendung aber wohl eine zulässige Polemik gegen Neurowissenschaftler, die die Öffentlichkeit mit völlig überzogenen explanativen Allmachtsphantasien überziehen. Wie gesagt, Allerfassungsansprüche lassen sich erkenntnissemantisch nicht rechtfertigen. Wer es "formaler" mag: Analog zum Extensionalitätsaxiom der Mengenlehre lässt sich sagen: Eine Aussage, die eine Menge von Aussagen umfasst, kann nicht zugleich ein Element dieser Menge sein. Ein Erkenntnissubjekt kann also Aussagen über ein Erkenntnisobjekt machen, ohne dass diese Aussagen damit zugleich für es als Erkenntnissubjekt gelten (auf diese Weise hat Bertrand RUSSEL das so genannte Kreter-Paradox: "Alle Kreter lügen, sagt ein Kreter" aufgelöst). [84] |
Ein Physiker, dem die gegenständlichen Grenzen seines Erkennens klar waren, war EDDINGTON (1928). Er lässt sich beispielsweise über zwei Schreibtische aus: Da ist einmal der Schreibtisch, den er sieht, an dem er sitzt, auf den er sich stützt und so weiter – der "Sinnenschreibtisch". Und dann ist da noch der Schreibtisch des Physikers – der "Schattenschreibtisch". Dieser ist ein sinnlich qualitätsloses raumzeitliches Arrangement physischer Einheiten, etwa eine atomare Zitterwolke oder ein Festkörpergebilde bestimmter materialer Zusammenstellung und Statik oder ... . Wenn man die ontische Differenz zwischen "Sinnen-" und "Schattenschreibtisch" vergisst, "so glaubt man leicht, dass (physikalische, U.L.) Theorien sinnliche Qualitäten erklären, was sie selbstverständlich niemals tun" (SCHRÖDINGER, 1989, S.147). Denn, so sagt der Sinnesphysiologe HENSEL (1962), "(d)ie Welt der Sinne (der sinnlichen Erscheinungen; U.L.) ist ... definitionsgemäß nicht Gegenstand der Naturwissenschaften" (S.748). [85]
Diese Einsicht SCHRÖDINGERs und HENSELs gilt es festzuhalten: Die Welt der physisch-naturwissenschaftlichen Denkform ist nicht die Welt, wie Menschen sie sinnlich erfahren, indem sie auf ihr herumlaufen, indem sie sich an ihr Beulen holen, indem sie in ihr Gegenstände hin und her tragen und anderes mehr. All dies sind Begegnungen mit Eigenarten einer pragmasemantisch gehaltvollen Welt (mehr dazu unter 4.5). Menschen erfahren die Eigenschaften dieser Welt, indem sie sich bedeutungsvoll handelnd in ihr bewegen und mit ihren Objekten umgehen. Mit GIBSON (1979) gesprochen: Es ist dies die Welt der handlungsbezüglichen Affordanzen. Und die Welt der Affordanzen ist nicht die Welt der physischen Denkform. Der physische Gegenstandsmodus schließt pragmasemantische Gehalte prinzipiell aus. Dies macht uns SCHRÖDINGER klar und EDDINGTON demonstriert eine Konsequenz. In der Redeweise EDDINGTONs gesagt, muss der Neurobiologe das "Sinnenhirn" vom "Schattenhirn" trennen. Dem "Sinnenhirn" begegnet er, wenn er beispielsweise den Schädel eines Makaken-Affen öffnet und eine gräuliche, gefältelte Glibbermasse erblickt. Dieses "Sinnenhirn" dient ihm als Datenlieferant, das heißt als Erkenntnismittel, um Hinweise zu erhalten, aus denen er die gegenständliche Beschaffenheit seines Erkenntnisgegenstands, des "Schattenhirns", erschließen kann. Dies mag als neuronales Netzwerk entworfen sein oder als atomare Zitterwolke oder als physikochemische Maschine oder ... . In ihm kommen Daten als empirische Gegebenheiten gegenständlich nicht vor. [86]
Mit dem Gegenstandsentwurf der physischen Denkform lässt sich unheimlich viel anfangen. Er ist äußerst produktiv gewesen und ist es immer noch. Er liefert die gedanklichen Grundlagen für zahllose technische Errungenschaften: Dampfmaschinen, Raketen, Hörgeräte, Chips, Magnetresonanztomographen, Medikamente, mit denen man in Stoffwechselvorgänge im Gehirn eingreifen kann, und so weiter. Die Erkenntnisse der physischen Denkform sind vielfältig verwertbar und wohl niemand möchte sie missen. Es gibt aber auch Erkenntnisse, die man ebenso wenig missen möchte und die sich nicht innerhalb der physischen Denkform gewinnen lassen. So möchte man beispielsweise wissen, durch welche sozialen Konstellationen zwischenmenschliche Konflikte entstehen und wie sie sich schlichten lassen. Oder man möchte wissen, wann Menschen einstellungsgemäß und wann sie einstellungswidrig handeln. Oder man möchte wissen, welche Informationen Menschen bei ökonomischen Entscheidungen verarbeiten. Oder man möchte wissen, bei welchem Problemtyp welche Problemlösungsstrategie die erfolgreichste ist, und anderes mehr. Für Antworten auf solche Fragen liefert der physische Gegenstandsmodus keine Antworten. Für Erkenntnisse dieser Art bedarf es eines anderen Gegenstandsentwurfs. In ihm muss genau das im Zentrum stehen, was aus dem physischen Kosmos "entfernt" wurde: Bedeutung oder Semantik. [87]
Damit habe ich den Übergang geschaffen zur semantischen Denkform, die ich als nächste Denkform besprechen werde. Doch zuvor muss ich noch einige Implikationen des Gegenstandsentwurfs der physischen Denkform explizieren, weil sie es sind, die ich später brauche, um der Frage nachzugehen, ob und gegebenenfalls wie sich in der physischen Denkform die Willensfreiheit erkenntnissemantisch unterbringen lässt. [88]
4.4 Einige Implikationen der Eigenart des Gegenstandsentwurfs der physischen Denkform
Der gerade erläuterten Zugehörigkeitsprobe und dem Ausschließungsprinzip mag man entgegenhalten, dass Neurowissenschaftler doch von all dem dauernd reden, was angeblich aus ihrem Gegenstandsetwurf entfernt worden ist. ROTH etwa antwortete (in dem erwähnten Philosophischen Quartett) auf die Frage Rüdiger SAFRANSKIs, was er als Neurowissenschaftler an Erkenntnis suche: "Ich suche die Wurzeln der Idee, aus denen mein Selbst besteht". Für den Tiefsinn dieser Antwort erntete er erstaunte Blicke und anerkennendes Kopfnicken. Aber: Diese Suche macht sich merkwürdig aus, wenn man sich SCHRÖDINGERs (1989) Feststellung: "Die materielle Welt konnte bloß konstruiert werden um den Preis, dass das Selbst ... daraus entfernt wurde" (S.60) in Erinnerung ruft. Wie kann sich ROTH als Neurowissenschaftler auf die Suche nach etwas machen, das aus dem Kosmos, den Naturwissenschaftler gegenständlich setzen, ausgeschlossen worden ist? [89]
Man muss zugestehen, Neurowissenschaftler reden in der Tat vom Ich, vom Geist, vom Bewusstsein, von Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühlen, Stimmungen, von Erinnerungen, von religiösen Erlebnissen und so weiter. Und all dies sind Größen, die bei der Zugehörigkeitsprobe glatt durchfallen. Es macht nämlich keinen Sinn beispielsweise nach der räumlichen Abmessung eines Selbst oder nach der elektrischen Ladung einer Erinnerung oder nach der Masse einer Wahrnehmung oder nach dem Bewegungszustand des Bewusstseins zu fragen. All dies sind folglich Größen, die im Gegenstandsentwurf der physischen Denkform nicht vorkommen. In welcher Weise aber reden Neurowissenschaftler dann davon? Wie kann man in einem Erkenntnisunternehmen von Größen reden, die sich in ihm erkenntnisgegenständlich nicht unterbringen lassen? [90]
|
Ergänzung Es gibt freilich auch Neurowissenschaftler, die zwar zugestehen, dass "a large part of the modern neuroscience community" (VANDERWOLF, 1998, S.134) "mentalistic concepts" verwendet, doch sollten die Neurowissenschaftler sich dies schleunigst abgewöhnen, weil solche Begriffe "do not provide a valid basis for scientific advances in behavior and brain function" (ebd.). "What I do propose is that neuroscience must attempt to disentangle the study of the brain and behavior from ancient speculations about psyche" (ders., 2003, S.273). Solche Ansichten kann man gut nachvollziehen, und zwar aus zweierlei Gründen: Erster Grund: Es mutet wahrlich sonderbar an, von Neurowissenschaftlern einerseits zu vernehmen, dass alle Erklärungen menschlichen Handelns, die auf "mentalistische Begriffe" zurückgreifen (auf Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Wollen, Entscheiden und so weiter), antiquiert, unbrauchbar und dem wissenschaftlichen Fortschritt hinderlich seien, um dann andererseits zu lesen und auf Tagungen zu hören, dass eben diese Neurowissenschaftler sich große Mühe geben (unter Einsatz immensen technischen Aufwands – PET, fMRI, MEP und andere Geräte), nach neuronalen Korrelaten eben jener antiquierten Größen zu suchen. Wie NYBERG (2001) in einer Publikationszusammenstellung zeigt, wächst die Zahl der Studien, in denen kognitive Prozesse "mentalistischen" Zuschnitts mit neuronalen Zuständen und Vorgängen korreliert werden, in den letzten Jahren exponentiell. Warum nur ist dies der Fall? Für die Neurowissenschaftler müsste doch gelten: "For most practical purposes it would suffice to know how sensory inputs control behavior, and autonomic and endocrine function" (VANDERWOLF, 1998, S.137). Weg also mit so antiquierten "mentalistischen Begriffen" wie "consciousness and awareness" (ebd.)! Denn ordentliche Neurowissenschaftler werden in die Irre geleitet, wenn sie danach suchen, welche "different brain functions" (S.125) den antiquiert-überkommenen Einteilungen des Geisteslebens korrelativ entsprechen. Eine Neurowissenschaft, die so vorgeht, begibt sich auf Abwege, denn sie orientiert sich an unwissenschaftlichen Vorgaben, die bereits der Neurophilosoph CHURCHLAND (1988) als solche entlarvt hat. Zweiter Grund: Wenn Neurowissenschaftler ihren Gegenstandsentwurf als physisch-naturwissenschaftlichen ernst nähmen, dann sollten sie in der Tat das Erforschen neuronaler Prozesse einerseits und jenes geistiger (mentaler, kognitiver, informationaler) Prozesse andererseits sauber auseinander halten ("disentangle"). Genau das ist es, wofür auch ich in diesem Artikel ganz entschieden plädiere. Leider bemühen die Neurowissenschaftler sich jedoch oft intensiv geradezu um das Gegenteil. Allerdings ist dieses Bemühen wenig erfolgreich. Warum sie sich bemühen, wie sie sich bemühen und warum das Bemühen wenig erfolgreich ist, das werde ich gleich in der Besprechung dreier "Versuche der gegenständlichen Verortung" erläutern. Zuvor aber sei noch eine andere Verortungsmöglichkeit "mentalistischer Begriffe" im naturwissenschaftlichen Erkenntnisprogramm bedacht – obgleich diese Möglichkeit, wie gleich nachvollziehbar sein wird, unter dem Zweifelsvorbehalt des "Ersten Grundes" steht. Es lässt sich nämlich fragen: Wozu taugen Indikatoren "mentalistischen Zuschnitts", der doch, wie Neurowissenschaftler meinen, unwissenschaftlich ist? – Aber dieser Zweifel sei im Folgenden hintangestellt. [91] |
4.4.1 Nicht-physische Größen als Erkenntnismittel
Man kann versuchen, Größen wie Gedanken, Ich, Gefühl und so weiter in anderen Abteilungen der vierstelligen Erkenntnisrelation unterzubringen. Dort können sie als Größen vorkommen, ohne die Zugehörigkeitsprobe bestehen zu müssen. Es soll die Abteilung der Erkenntnismittel durchdacht werden. Die Möglichkeit, sie dort forschungsheuristisch sinnvoll unterzubringen, ist zum einen an bestimmte Voraussetzungen gebunden und sie zieht zum anderen bestimmte Folgen nach sich. Beides sei kurz durchdacht. [92]
Voraussetzungen: Eine wichtige Voraussetzung, um als ein wertvolles Erkenntnismittel fungieren zu können, sehen die Neurowissenschaftler als gegeben an. Sie gehen nämlich davon aus, dass Größen wie Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Erinnerungen, Vorstellungen und so weiter neuronalen Zuständen und Vorgängen parallel laufen, dass sie sie begleiten, dass sie ihnen konkomitant sind, dass sie mit ihnen korrelativ verbunden sind und dergleichen Ausdrucksweisen mehr: "This bit of the brain lights up when a man is in pain, this when he conjures up a visual image, this when he tries to remember which day of week it is, and so on" (HUMPHREY, 2000, S.6). Die fraglichen Größen liegen mithin außerhalb der Welt der physischen Größen, gehen aber mit solchen einher. Und als solche sind sie für Neurowissenschaftler hoch interessant und forschungspraktisch geradezu unentbehrlich. Sie können ihnen nämlich als Indikatoren für bestimmte neuronale Zustände und Vorgänge dienen. Sie fungieren dann in einer erkenntnissemantischen Stellung, die vergleichbar ist mit den indizierenden Beobachtungsdaten in naturwissenschaftlichen Erkenntnisunternehmen. Von den Beobachtungsdaten sagt Max PLANCK (1943) in bildhafter Wendung, sie seien "ein Zeichen, das die reale Welt ihm (dem Wissenschaftler, U.L.) übermittelt" (S.174). Und so dienen sie als Erkenntnismittel. [93]
Folgerungen: Bringt man Größen wie Selbst, Gedanken, Gefühle, Erlebnisse und so weiter derart als wichtige Größen in der Rubrik der Erkenntnismittel unter, dann muss man sich aber der Folgen klar sein:
Die fraglichen Größen werden dadurch deobjektiviert: Sie sind nicht Einheiten, die im Gegenstandsentwurf der physisch-naturwissenschaftlichen Denkform vorkommen. Sie können folglich nicht Erkenntnisgegenstände der physischen Denkform sein, so dass sich über sie auch keine gegenständlichen Existenz- oder Beschaffenheitsaussagen machen lassen.
Sie werden dadurch indikatorisiert: Sie gelten und fungieren als Hinweise auf physische Größen, denen sie parallel laufen sollen. Sie dienen somit als Erkenntnismittel. Als solche brauchen sie die Zugehörigkeitsprobe nicht zu überstehen, so wie Beobachtungsdaten allgemein diese nicht zu überstehen brauchen. [94]
Hier zeigt sich abermals, wie wichtig es ist, sich die basissemantischen Differenzen des Erkennens klar zu machen. Man kann bestimmte Größen (z.B. erlebte Gefühle) als Erkenntnismittel fungieren lassen, obgleich diese Größen als Erkenntnisgegenstände inexistent sind. So wie es ja auch nicht stört, dass Erkenntnisergebnisse, etwa physikalische Modelle, im physischen Kosmos als Modelle gegenständlich inexistent sind. [95]
|
Ergänzung Wenn ROTH im Gehirn nach den Wurzeln der Idee seines Selbst sucht, so kann er allenfalls irgendwelche neuronalen Größen ausmachen, die dem, was er als die Idee seines Selbst erfährt, parallel laufen. Ob es angemessen ist, in Korrelationen "Wurzeln" zu erblicken, erscheint fragwürdig. Denn unverändert gilt Gustav Theodor FECHNERs über hundert Jahre alte Feststellung: "Ein anderer, der in mein Gehirn blickt, während ich eine Landschaft sehe, nimmt 'Störungen' und 'Schwingungen' der 'tätigen Nerven' wahr. Er sieht nur 'weiße Nervenmasse', während ich 'Seen, Bäume, Häuser sehe'" (FECHNER, zit.n. OELZE, 1988, S.147). Gleiches gilt, wenn ROTH "sein Selbst" oder die "Idee" desselben erlebt. [96] |
Es gilt bislang weiterhin: "Nun, unser Schädel ist nicht leer. Aber, was wir darin vorfinden, so interessant es ist, ist wahrhaftig nichts, wenn es um Gefühlswerte oder das Erleben ... geht" (SCHRÖDINGER, 1989, S.70). [97]
Diese Schlussfolgerung, so ist zu vermuten, schmeckt einigen neuropsychologischen Emotionsforschern gar nicht. Sie wollen sich nicht damit zufrieden geben, dass sie Gefühle in ihren Forschungsprogrammen allein als deobjektivierte psychische Konkomitanten unterbringen können, also als indizierende Erkenntnismittel. Deshalb streben sie danach, Gefühle auch irgendwie erkenntnisgegenständlich so unterzubringen, dass sie sagen können, sie seien in der Lage, über Gefühle gegenständliche Existenz-, Beschaffenheits- und Kausalaussagen machen zu können. Mit einigen dieser Bemühungen muss ich mich hier auseinandersetzen, da mit ihnen die Plätze geschaffen werden sollen, auf denen manche Neurowissenschaftler dann auch die Willensfreiheit gegenständlich verorten wollen. Ich will drei solcher gegenständlichen Verortungsversuche unterscheiden. Es sind dies also Versuche, das zu widerlegen, was SCHRÖDINGER (1989) meint, wenn er sagt, dass z.B. Gefühle als Erlebensgrößen "sich von einem rein naturwissenschaftlichen Standpunkt (in den Gegenstandsentwurf der Naturwissenschaften; U.L.) überhaupt nicht organisch einbauen lassen" (S.60). Und ich will schon vorweg sagen, es bleibt bei SCHRÖDINGER. Alle Verortungsversuche erweisen sich als Fehlversuche. Aber das muss ich natürlich argumentativ belegen. [98]
4.4.2 Erster Versuch der gegenständlichen Verortung: Pendeln zwischen Korrelation und Kausalität
Das Erleben, geistige Prozesse, Bewusstseinstatsachen, Gefühle und so weiter, alles Größen, die aus dem physischen Kosmos "entfernt" worden sind, sollen ihm nun wieder irgendwie kausal eingefügt werden und zwar so: HAGGARD und LIBET (2001) sprechen von "causal relations between brain preparation and conscious awareness" (S.50). SEARLE (2000) sagt: "All our conscious states are caused by lower-level neural processes in the brain ..." (S.4). Bei beiden Autoren finden wir aber auch Aussagen, die diese Kausalitätsbehauptungen wieder aufheben oder relativieren. So spricht SEARLE an anderer Stelle von dem "neural correlate of consciousness" (S.5). Und HAGGARD und LIBET (2001) charakterisieren an anderer Stelle die Beziehung zwischen Gehirn und Bewusstsein als "consequence or correlate" (S.47). Ja, was denn nun, Kausalität oder Korrelation? Kausalität würde implizieren, dass fragliche Erlebensgrößen gegenständliche Bestandteile des Kosmos sind, in dem sie erklärt werden sollen. Korrelation kann auch zwischen Größen bestehen, die ontisch unterschiedlichen Gegenstandsentwürfen angehören. Derartige Korrelationen können Indikatorbeziehungen begründen, nicht aber Kausalbeziehungen, denn für diese gilt immer noch: "No physical action waits on anything other but another physical action" (MAC KAY, 1966, S.438). Da nun aber "psychische Größen" keine "physical actions" sind, die die Zugehörigkeitsprobe überstehen, lassen sie sich in der physischen Denkform nicht kausal erklären, darüber hilft auch die korrelative Anbindung, und sei sie noch so strikt ("neuronale Prozesse und ... geistig-psychische Zustände hängen aufs Engste miteinander zusammen", ELGER u.a. 2004, S.33), nicht hinweg. [99]
Der Begriff der strikten Korrelation taugt nicht, um die aus dem physischen Kosmos ausgeschlossenen psychischen Größen wieder in ihn einzuschleusen. Das war der erste Fehlversuch (zum so genannten "korrelativen Erklären" komme ich später). [100]
4.4.3 Zweiter Versuch der gegenständlichen Verortung: "Geist als physikalischer Zustand"
Das Verortungsproblem lautet: "(F)inding a place for mind in a world that is fundamentally physical" (KIM, 1998, S.2). Eine schlichte Antwort gibt ROTH (1997, S.300ff.). Bei ihm heißt es: "Geist kann als ein physikalischer Zustand verstanden werden, genauso wie elektromagnetische Welle, Mechanik, Wärme, Energie" (S.301). Man braucht für den "Geist" also gar keinen Platz im physischen Kosmos zu suchen, denn er ist schon in ihm drinnen. Auch Aussagen SPERRYs (1987) kann man so lesen, etwa wenn er sagt, das Bewusstsein sei ein "spatio-temporal arrangement". MONTERO (2001) fasst solche Ansichten in Existenz-Sätze wie: "(C)onsciousness is physical" (S.61) oder: "(M)ind ... must be fundamentally physical" (ebd.). Bewusstsein und Geist sind also Größen, die physischer Qualität sind. Und folglich gilt: "Geist und Bewusstsein ... fügen sich also in das Naturgeschehen ein ..." (ELGER u.a., 2004, S.33) [101]
Dazu kann man nur sagen: Wohlan denn! Hic Rhodus, hic salta! Das sind Behauptungen, die des Belegs harren. Elektromagnetische Welle, Mechanik, Wärme und so weiter, all das sind Größen, die als physikalische die Zugehörigkeitsprobe spielend überstehen. Es macht Sinn, auf sie bezogen "cm, g, sec"-Fragen zu stellen. Eben diese Fragen ergeben aber keinen Sinn, wenn man sie im Blick etwa auf den geistigen Akt einer Entscheidung stellt. Es ist nicht sinnvoll, nach der räumlichen Abmessung oder der kinetischen Energie eines Gedankens zu fragen. ROTH, SPERRY und ELGER u.a. haben bislang nicht belegt, dass solche Fragen gegenständlich sinnvoll im Blick etwa auf geistige oder Bewusstseinsgrößen gestellt werden können. Das aber müssten sie leisten, sollten ihre Behauptungen berechtigt sein, denn im "Naturgeschehen" haben nur solche Größen einen gegenständlichen Platz, die die Zugehörigkeitsprobe überstehen. [102]
Der Versuch ROTHs, geistige Größen dadurch dem physischen Kosmos einzuverleiben, dass er sie in die Aufzählung physischer Größen schlicht einreiht, ist ebenfalls ein Fehlversuch, der zweite. [103]
4.4.4 Dritter Versuch der gegenständlichen Verortung: "Geist als Eigenschaft der Materie"
Bereits im Jahre 1909 berichtet MEYER von der Auffassung einiger Wissenschaftler seiner Zeit, dass "das Geistige als eine Eigenschaft ... der Materie anzusehen sei" (S.38). Bei SEARLE (2000) finden wir die Aussage, dass Bewusstseinsgegebenheiten "features of the brain" (S.4) seien. Humphrey (2000) umschreibt diese Auffassung (die nicht seine ist) so: "Consciousness just happens to be a fundamental, non-derivative, property of matter" (S.6). Auf diese Weise kann man behaupten, dass man, wenn man über Gehirnzustände redet, damit zugleich über deren geistige oder mentale Qualitäten redet, so dass sich eine gesonderte Betrachtung dieser Qualitäten erübrigt (vgl. z.B. CHURCHLAND, 1988; FLOHR, 1996; SINGER, 1998). Alle "innerpsychischen Prozesse" sind demnach "grundsätzlich durch physikochemische Vorgänge beschreibbar" – so heißt es in einem "Manifest" von "elf führenden Neurowissenschaftlern" (ELGER u.a., 2004, S.33). [104]
Das sieht auf den ersten Blick wie eine pfiffige Lösung aus. Den "cm, g, sec"-Eigenschaften, die allen physischen Größen zukommen, brauchen wir nur noch eine, sagen wir mal, "Geisteseigenschaft" hinzufügen, und schon haben wir "das Geistige" gegenständlich eingefangen und im physischen Kosmos untergebracht. Die Antwort auf die Frage, ob diese Lösung eine sinnvolle ist, ergibt sich aus der Antwort auf die "Ohne anders?"-Frage. Dazu zunächst folgende Vorüberlegung und Setzung: Innerhalb eines wissenschaftlichen Erkenntnisunternehmens von Eigenschaften der Erkenntnisgrößen zu reden, macht nur dann Sinne, wenn eben diese Eigenschaften kausal relevant sind. Sie müssen sich durch spezifische Wirkungen ausweisen lassen. Eigenschaften, die kausal irrelevant sind, kann man beliebig hinzudichten oder es sein lassen. Sie haben deshalb in einem wissenschaftlichen Erklärungsprogramm nichts zu suchen und lassen sich innerhalb eines solchen auch nicht erklären. [105]
Es gibt eine einfache Probe, um herauszufinden, ob eine genannte Eigenschaft eine kausal relevante (und damit eine erklärende oder erklärbare) ist. Man stelle die "Ohne anders?"-Frage. In dem hier thematischen Zusammenhang frage man sich: Verläuft ein neuronaler elektrochemischer Geschehenszusammenhang, von dem gesagt wird, eine seiner Eigenschaften sei geistiger Beschaffenheit, anders, sofern man diesem Geschehenszusammenhang eben diese geistige Eigenschaft nähme – also ohne sie? Wird diese Frage nicht beantwortet oder gar verneint (z.B. weil elektrochemische Zusammenhänge allein elektrochemisch zusammenhängen), dann ist damit erwiesen, dass die Geisteseigenschaft kausal irrelevant ist. Sie erklärt dann nichts und wird durch nichts erklärt. [106]
Mir ist nicht bekannt, dass "mental features" bestimmter neuronaler Prozesse die "Ohne anders?"-Probe irgendwo überstanden haben. Das heißt, es handelt sich bei dieser "Eigenschaft der Materie" um eine beliebige Hinzudichtung. So ließe sich auch behaupten, dass jedes Gehirn von einer Schar kleiner Engel umwölkt sei. [107]
Der dritte Versuch, psychische Größen dem Gegenstandsentwurf der physischen Denkform einzuverleiben, geht gleichfalls fehl. [108]
|
Ergänzung Der "Ohne anders?"-Probe fallen auch noch drei andere Versuche, Geistiges/Psychisches/Mentales/Semantisches/Bedeutungshaftes/Phänomenales (hier alles ununterschieden zusammengenommen) dem Gegenstandsentwurf der physischen Denkform ein- oder anzufügen, zum Opfer: Erstens: Auch all jene Ansätze fallen der Probe zum Opfer, die den Gedanken durchspielen, ob man nicht physischen Einheiten generell und wesenseigen (zumindest proto-) phänomenale Eigenschaften zuschreiben könne. Die Frage: "Is mentality a fundamental feature of the world?" (MONTERO, 2001, S.78) wird bejaht. Die Idee, dies zu tun, ist nicht neu. So sagt beispielsweise SCHÄFFLE (1875-78): Bereits in der anorganischen Welt finden wir das "charakteristische Merkmal des Psychischen, die Empfindung ..., (denn) schon die anziehenden und abstoßenden Bewegungen der Atome (werden von manchen) als eine durch die ganze Welt ausgebreitete Empfindsamkeit aufgefasst" (Bd.1, S.25). Wolfgang KÖHLER (1960) vermutet fast ein Jahrhundert später: "Suppose that all events in nature have phenomenal characteristics of a more or less kind" (S.23). In neuerer Zeit finden wir derartige (panpsychisch anmutenden) mikrophänomenalen Gedankengänge bei Autoren wie CHALMERS (1996) oder bei BOLENDER (2001). Sie sind jedoch solange haltlose Irrlichter im Kosmos der physisch-naturwissenschaftlichen Denkform, solange dieser kausal so gestrickt ist, wie er es ist – abgesehen davon, bleibt bei diesen Gedanken gänzlich offen, wie sich aus irgendwelchen phänomenalen Partikeln die phänomenale Lebenswelt eines Menschen (vgl. Abschn. 4.7) bilden soll. Zweitens: Auch die Emergenz-Erklärungen (hier gleichgültig, ob in der "emergence1"- oder der "emergence2"-Fassung, SEARLE, 1992) des phänomenalen Bewusstseins (vgl. z.B. KIM, 1992; NEWTON, 2001) fallen der "Ohne anders?"-Probe zum Opfer. Phänomenale Bewusstseinsgegebenheiten sind dieser Erklärung nach holistisch-emergente (aus dem Ganzen neu auftauchende) Eigenschaften neuronaler Prozesse, etwa solcher, die eine gewisse evolutionär entstandene Komplexität erlangt haben (vgl. z.B. COTTERILL, 2001). Dazu ist Folgendes zu sagen: Die emergenten Eigenschaften des Wassers (z.B. Gefrierpunkt), die sich aus den Eigenschaften der Elemente Wasser- und Sauerstoff nicht ableiten lassen, sind wiederum Eigenschaften, welche die Zugehörigkeitsprobe überstehen und somit im physischen Kosmos kausal relevant sind. Genau dies aber gilt nicht für emergente Bewusstseinseigenschaften. Sie überstehen weder die Zugehörigkeits- noch die "Ohne anders?"-Probe. Der bei manchen Neurowissenschaftlern so beliebte Begriff der Emergenz (z.B. "Geist und Bewusstsein ... haben sich in der Evolution des Nervensystems allmählich herausgebildet", ELGER u.a., 2004, S.33) taugt nicht dazu, das phänomenale Bewusstsein physisch einzufangen und kausal unterzubringen - abgesehen davon, dass das Emergieren von etwas Phänomenalem aus etwas Physischem "somewhat mysteriously" (FEINBERG, 2001, S.124) ist. Drittens: Es geht um wundersame Geschichten der Bedeutungsgenese. Ein schönes Beispiel ist ROTHs (2004b) "Konstruktion von Bedeutung" (S.497). Sie soll so vonstatten gehen: "Wenn ein Sprecher Wörter spricht, so produziert er Schallwellen, die an das Innenohr und schließlich – in Nervenimpulse umgewandelt – in das Gehirn des Hörers eindringen. Dort werden sie im Bruchteil einer Sekunde einer komplizierten Analyse nach Frequenzen, Amplituden und zeitlichen Beziehungen der Schwingungen und Schwingungsüberlagerungen unterzogen und dann als menschliche Sprachlaute identifiziert. Danach werden sie sofort in Hirnzentren gelenkt, die angeborenermaßen für menschliche Sprache zuständig sind, nämlich in das Wernicke- und das Broca-Areal. Hier werden nacheinander Phoneme und Phonemgruppen, primäre Wortbedeutungen, syntax- und grammatikabhängige Wortbedeutungen (linke Hirnrinde) sowie Sprachmelodie und affektiv-emotionale Bestandteile der Sprache (rechte Hirnrinde) analysiert. Jedes als Wort, Wortgruppe und Satz identifizierte Ereignis wird ... mit Inhalten des Sprachgedächtnisses verglichen, und es werden diejenigen bereits vorhandenen Bedeutungen aktiviert und neu zusammengestellt, die den größten Sinn machen. Hierbei wird meist auch der weitergehende Bedeutungs- und Handlungskontext einbezogen ..." (S.497f.). ROTH pendelt in diesen "Analysen" munter zwischen physischen (z.B. neuronale Vorgänge in der linken Hirnrinde) und semantischen Größen (z.B. Inhalte des Sprachgedächtnisses) hin und her, so als ließen sich semantische Größen problemlos in den physischen Kosmos einfügen oder so als ergäben sich beide problemlos auseinander oder so als seien die einen problemlos Eigenschaften der andern. Dass dies, das oder jenes keineswegs problemlos ist, ergibt sich aus einem Zitat, das von SCHRÖDINGER (1989) stammt: "Wir können die Druckschwankungen der Luft verfolgen, wie sie Schwingungen des Trommelfells erregen; wir können beobachten, wie dessen Bewegungen durch ein System von Knöchelchen auf eine andere Membran in der Schnecke übertragen werden, die aus verschieden langen Fasern besteht. Wir können ein Verständnis dafür gewinnen, wie eine solche schwingende Faser einen elektrischen und chemischen Leitungsvorgang in der Nervenfaser, mit der sie in Wechselwirkung steht, hervorruft. Wir können diesen Leitungsvorgang bis in die Hirnrinde verfolgen und möglicherweise auch ein gewisses objektives Wissen über einiges von dem erlangen, was sich dort abspielt. Aber nirgends werden wir auf dieses 'einen Schall wahrnehmen' stoßen, das in unserem wissenschaftlichen Bilde (vom physischen Kosmos; U.L.) einfach nicht enthalten ist ..." (S.134f.), denn dem Kosmos "der Naturwissenschaft (mangelt) alles, was Bedeutung ... hat" (S.96). Bedeutung lässt sich weder in ihm finden, noch kann Bedeutung "von einem naturwissenschaftlichen Standpunkt überhaupt ... organisch eingebaut werden" (ebd.). Die "Ohne anders?"-Probe zeigt dies deutlich. Sie entlarvt ROTHs Übergänge von physischen zu semantischen Analysen als grundlegend verfehlt. Die "Ohne anders?"-Probe wirft hier z.B. folgende Frage auf: In welche Weise würden neuronale Vorgäng im Wernicke- oder im Broca-Areal anders verlaufen, sofern ihnen keine "Wortbedeutungen" parallel liefen, also ohne sie? Welches bedingungskausale Wirkquantum kommt mithin den "Wortbedeutungen" als solchen zu? Gibt es darauf keine Antwort (und ROTH gibt keine), dann ist das Gerede von der "Konstruktion von Bedeutung" eine beliebige und kausal irrelevante Zufügung, ohne jeden Halt im physischen Kosmos und daher in diesem weder erklärend noch erklärt. Das Wunder der Bedeutungsgenese im Gehirn modo ROTH beruht auf einem sprachlichen Trick. Solche Wunder folgen einem immer wiederkehrenden Strickmuster: Prozesse der sprachlichen Bedeutungsverarbeitung, wie sie von manchen kognitiven Informationsverarbeitungstheorien oder von unser aller naiv-psychologischem Umgangswissen angenommen werden, werden neurosprachlich paraphrasiert und dann wird behauptet, diese Paraphrasierung liefere die Erklärung der Prozesse der Bedeutungsverarbeitung. Das erinnert mich immer an eine Sentenz, über die wir als Studenten herzlich gelacht haben. In dem handlich-kleinformatigen Psychiatrie-Kompendium von Theodor SPOERRI wurde aus dem "Erinnern" ein "Ekphorieren neuronaler Engramme", und damit galt es natürlich als erklärt. Oder jüngst vernahm ich in einer Fernsehdiskussion, dass Menschen die Handlung eines Mitmenschen nicht mehr "nachmachen", sondern bei ihnen werden die "Mirror-Neuronen" aktiviert. Und schon wieder ist alles erklärt. [109] |
Alle drei Versuche, Geistiges, Bewusstseinsgegebenheiten, Erleben und so weiter im physischen Kosmos kausal relevant unterzubringen, sind gescheitert. Es bleibt dabei, wer "Selbst", "Geist", "Gedanken", "Gefühle", "Strebungen" und so weiter gegenständlich erfassen und kausal einordnen will, muss einen Kosmos gegenständlich so entwerfen, dass all dies nicht aus ihm "entfernt" wird, sondern für ihn gegenständlich einschlägig ist. – Damit kann ich nun endlich zur semantischen Denkform und ihrem Gegenstandsentwurf übergehen. [110]
4.5 Semantische Denkform und ihr Gegenstandsmodus
Die semantische Denkform erhebt das zu ihrem Gegenstand, was in der physischen Denkform aus deren Gegenstandsentwurf ausdrücklich entfernt wurde: Bedeutung (griech. semantikos = bedeuten). Blickt man auf das oben gegebene Beispiel (vgl. 4.2) unterschiedlicher Vergegenständlichungen eines Klienten durch einen Psychotherapeuten zurück, so gerät nun der kognitionstheoretisch orientierte Psychologe ins Blickfeld, der seinen Klienten als ein bedeutungsverarbeitendes Wesen begreift. [111]
|
Ergänzung Was das heißt, mag noch mit einem zusätzlichen Beispiel erläutert werden. Man stelle sich einen Schachspieler, der in einem Schachspiel eine Figur setzt, vor. In der semantischen Denkform gilt: Sein Handeln ist bedeutungshaltig – er vollzieht einen bestimmten Schachspielzug. Seine Umwelt ist bedeutungshaltig – es liegt eine bestimmte Schachfigurenkonfiguration vor. Sein Denken ist bedeutungshaltig – er denkt: wenn ich den Zug X mache, dann verleite ich hoffentlich meinen Gegenspieler, den Gegenzug Y zu machen, dann kann ich den strategisch wichtigen Zug Z machen. Sein Fühlen ist bedeutungshaltig – er ärgert sich, weil der Gegenspieler sich nicht verleiten ließ ... und so geht es weiter – durch und durch bedeutungshaltig. Die Bedeutung, das soll dieses Beispiel zeigen, beginnt also nicht erst im Kopf des Schachspielers, sondern sie existiert bereits in der Umwelt, und sie endet auch nicht im Kopf, sondern setzt sich fort im Handeln, das bedeutungshaltige Veränderungen einer bedeutungshaltigen Umwelt bewirkt. Abstrahiert man von dem Schachbeispiel, so lässt sich sagen: In der semantischen Denkform werden Menschen als Wesen vergegenständlicht, die ein semantisch artikuliertes und strukturiertes Leben führen. Und sie führen dieses Leben in einer Umwelt (sei sie sächlich, sei sie dinglich, sei sie mitmenschlich), die in sich semantisch gehaltvoll ist. Durch seine Lebensführung greift der Mensch semantische Gehalte der Umwelt auf und verändert solche durch sein Handeln (ausführlich in LAUCKEN, 2003a, S.132ff.). [112] |
Formal analog zum Gegenstandsmodus der physischen Denkform lässt sich der Gegenstandsmodus der semantischen Denkform folgendermaßen bestimmen:
Es gibt eine semantische Realität. Es gibt semantische Einheiten. Zwischen diesen Einheiten bestehen Verweisungszusammenhänge. Veränderungen solcher Zusammenhänge sind zeitlich erstreckt und verweisungskausal bewirkt. In seinen Wirkbeziehungen ist die semantische Realität kausal geschlossen. [113]
Semantische Einheiten (oder Bedeutungseinheiten) sind (inhaltliche) Differenzen (oder Unterscheidungen) (z.B. "jemand erklärt sich bereit, an dem Experiment LIBETs mitzumachen/jemand erklärt sich nicht bereit, an dem Experiment LIBETs mitzumachen"), die mit anderen Differenzen (z.B. "jemand will dem Versuchsleiter einen Gefallen tun/jemand will dem Versuchsleiter keinen Gefallen tun") durch einen Verweisungszusammenhang verbunden sind (z.B. "wenn jemand dem Versuchsleiter einen Gefallen tun will, dann erklärt er sich bereit, an dem Experiment mitzumachen/wenn jemand dem Versuchsleiter keinen Gefallen tun will, dann erklärt er sich nicht bereit, an dem Experiment teilzunehmen"). [114]
Konstitutiv für den semantischen Gegenstandsmodus ist die in ihm herrschende Verweisungsbeziehung. Es ist dies eine Beziehung, die inhaltliche Differenzen nach bestimmten Verweisungsmodalitäten aufeinander bezieht: wenn A, dann B; A ist ein Fall von B; aus A und B folgt C; A impliziert B; A und B sind (inhaltlich) assoziiert; an A (z.B. ein Baum) kann B (z.B. Hochklettern) vollzogen werden; an A (z.B. ein Gruß) kann B (z.B. ein Gegengruß) anschließen ... und dergleichen mehr. Sowohl die Lebensführungen einzelner Menschen jeweils für sich genommen als auch die sozial koordinierten Lebensführungen verschiedener Menschen werden in der semantischen Denkform als durchgängig verweisungsstrukturiert angesehen. Das Handeln der Menschen, ihr Tun und Lassen, der Umgang miteinander, all dies ist bedeutungsartikuliert und -strukturiert und verweisungskausal verbunden. [115]
|
Ergänzung Von all dem auszugehen, ist den Alltagsmenschen sehr vertraut. So geht jede Motivsuche eines Detektivs von einem semantisch vergegenständlichten Menschen aus. Und wer Interessenkonflikte zwischen Lobbyisten für möglich hält, der vergegenständlicht soziale Beziehungen als semantische. Ich erwähne diese Beispiele hier nur, um zu zeigen, dass die abstrakte Bestimmung etwas sehr Vertrautes meint, was in der Abstraktion vielleicht etwas befremdlich klingt. [116] |
Der Kosmos der semantischen Denkform ist eine eigene Totalität, die in sich verweisungsbezüglich geschlossen ist. Diesbezüglich gleicht ihr Kosmos dem bedingungskausal geschlossenen physischen Kosmos. Ebenfalls formal analog dem physischen Kosmos lässt sich der semantische Kosmos unterschiedlich zerlegen. Bildlich mag man verschiedene Ebenen trennen: Mikroebene (z.B. Informationen bei der sensorischen Mustererkennung), Mesoebene (z.B. handlungsbezügliche Entscheidungskalküle), Makroebene (z.B. milieuspezifische Mentalitäten). [117]
Die Einheiten semantischer Zusammenhänge sind keine luftigen Größen, sie sind vielmehr sehr bodenständig. Sehr deutlich wird dies bei der Erforschung pragmasemantischer Zusammenhänge. In ihnen sind Handlungen (griech. pragma = Handeln) die zentralen Struktoren. Dies können instrumentelle oder kommunikative Handlungen sein. Es sind dies leibhaftige Handlungen leibhaftiger Menschen. Die Menschen stehen durch ihre Handlungen in Verweisungsbezügen zu Größen wie Mitmenschen (z.B. Begrüßung), wie Institutionen (z.B. Straßenkreuzung), zu terrestrischen Größen (z.B. Baum, Steine, Berge), zu baulichen Gebilden (z.B. Haus, Stadt) und dergleichen mehr. All dies sind semantische Größen. Sie erhalten ihre pragmasemantischen Differenzqualitäten, ihre Bedeutungsqualitäten durch die operativen Umgangsmöglichkeiten, die ihnen (handlungsbezüglich objektiv) zueigen sind. Freilich umfasst der semantische Kosmos auch handlungsbezügliches Denken, Fühlen und Wollen, doch sind diese semantischen Größen und ihr Prozessieren pragmasemantisch fest verweisungsverankert. Der pragmasemantische Mensch ist also kein entleibtes reines Geistwesen, sondern ein durch sein Handeln seiner Umwelt leiblich verbundenes. Die pragmasemantische Leiblichkeit ist dabei eine semantische. [118]
All dies zu erwähnen und hervorzuheben, ist hier erforderlich, weil sich damit zeigt, dass es ein Fehlurteil ist, der semantischen Denkform vorzuhalten, sie postuliere einen irgendwie freischwebenden Geist. Manche Neurowissenschaftler (z.B. ROTH, 2000; VANDERWOLF, 1998) gefallen sich darin, der semantischen Denkform dies vorzuhalten (z.B. "Geist und Bewusstsein sind nicht vom Himmel gefallen ...", ELGER u.a., 2004, S.33), um dann ihre Denkform vorzuschlagen, die wieder gegenständliche Bodenhaftung zu liefern vermag. Der "Geist" der semantischen Denkform ist sehr irdisch, sehr praktisch und sehr handfest. Dies zeigt sich auch noch in Folgendem. [119]
Als Forscher kann man die verweisungskausal-funktionale Rolle einer bestimmten Handlung eines einzelnen Menschen in einen individuellen Zusammenhang stellen. Dann geht es um die Verweisungscharakteristik dieser Handlung im Lebensvollzug eines einzelnen Menschen. Man kann eine bestimmte Handlung aber auch in einen interindividuellen (oder sozialen) Zusammenhang stellen. Dann geht es um die Bedeutung einer Handlung, die sich aus ihrer funktionalen Stellung in einem Netz von Anschlusshandlungen verschiedener Menschen ergibt. Je nach Einordnung kann eine bestimmte Handlung eine unterschiedliche Bedeutung erhalten. [120]
Ein einfaches Beispiel: Ein individualsemantisch gesehen missglückter Querpass in einem Fußballspiel kann sozialsemantisch gesehen eine hervorragende Vorlage zum Torschuss eines Mitspielers sein. [121]
4.6 Einschub: Willensfreiheit als semantisch prozessiertes Konstrukt
Die skizzenartige (ausführlich in LAUCKEN, 2004) Entfaltung der semantischen Denkform bis zu der Unterscheidung zwischen individual- und sozialsemantischer Betrachtung des Handelns in diesem Text hat einen Grund, der mit der "Willensfreiheitsdebatte" (ROTH, 2004a) zu tun hat, allerdings in einer Weise, die ich als "Einschub" kennzeichne. Es geht jetzt nämlich nicht um die von Neurowissenschaftlern aufgeworfene Frage der Existenz oder Inexistenz der Willensfreiheit als einer Realität, sondern es geht um die Willensfreiheit als Konstrukt (als Begriff) und um dessen forschungsthematische Vergegenständlichung. [122]
In dem oben erwähnten Philosophischen Quartett (aber auch in anderen Erörterungszusammenhängen) tut dies ROTH in folgender Weise. Er sagt, die Willensfreiheit als Realität sei eine Illusion (neurowissenschaftlich erwiesen, wie er meint), als Konstrukt sei sie aber, so vermutet er, durchaus nützlich. Als in zwischenmenschlichen Diskurszusammenhängen sozial prozessiertes Konstrukt mag die Willensfreiheit sozialfunktional dienstbar sein, etwa bei der (sozial-systemischen) Erhaltung einer bestimmten Rechtsprechungspraxis. ROTH (aber auch SINGER, s.o.) meint freilich, dass bei einem solchen sozialpraktischen Nutzen zu bedenken sei, dass dieser Nutzen einem Konstrukt geschuldet ist, welches den Menschen eine nicht vorhandene Realität vorgaukele. Besser wäre es doch wohl (so deute ich seine Vorschläge zu einer Veränderung der Strafpraxis, s.o.), wenn die Rechtsprechungspraxis Konstrukte prozessierte, die sich auf Realitäten bezögen (d.h. keiner Illusion nachhingen). Ist die Willensfreiheit, so mag man bei solcher Illusionsentlarvung sozialsemantisch denkend weiterfragen, vielleicht sogar ein ideologisches Werkzeug in den Händen (machtpolitisch irgendwie) Interessierter? ROTH und SINGER als Ideologiekritiker? – im Gefolge etwa FEUERBACHscher Religionskritik. [123]
Freilich lässt sich auf vergleichbare Weise auch die Illusionierung der Willensfreiheit, vollzogen durch eine Schar von Neurowissenschaftlern in den Massenmedien, als sozial prozessiertes Konstrukt ideologiekritisch in den Blick nehmen. Viele so genannte Resozialisierungsmaßnahmen gehen davon aus, dass Menschen, die beispielsweise straffällig geworden sind, unter anderem durch moralische Erziehung und Gewissensbildung davon abgebracht werden können, sich weiterhin sozial schädlich zu verhalten. Menschen werden dabei als der Besinnungswillensfreiheit mächtige angesehen. Erklärt man diese zu einer Illusion, dann wird bestimmten Umgangspraxen mit Straftätern der Boden entzogen und anderen wird der Boden bereitet. Mit Naturkatastrophen geht man anders um als mit bedachtem oder zumindest bedenkbarem Handeln. Eine Flut etwa dämmt man ein, man redet nicht mit Mond, Wind und Wasser. Vergleichbar wird das physische Wegsperren von Straftätern nahe gelegt. Dies hat nicht nur moralische und strafrechtliche Folgen, sondern auch weitgehende ökonomische. Gibt es Interessenten für diese? Denken wir etwa an das erstaunliche Aufblühen des privatwirtschaftlich organisierten Gefängniswesens in den USA. [124]
Auch die "Illusionierung der Willensfreiheit" geht ja einher mit bestimmten Wahrheitsbehauptungen. Eben solche nimmt sich die sozialfunktionale Diskursanalyse vor, indem sie fragt: "Was ist das für eine Macht, die imstande ist, Wahrheitsdiskurse zu produzieren, die in einer Gesellschaft wie der unseren mit so machtvollen Wirkungen ausgestattet sind" (FOUCAULT, 2003, S.232). Eine derart sozialfunktionale Analyse der "Illusionierung der Willensfreiheit" könnte ein kleines Beispiel für das "innige Verhältnis zwischen Macht, Recht und Wahrheit" (ders., S.233) sein. "Letztlich werden wir gemäß wahren Diskursen, die spezifische Machtwirkungen mit sich bringen, be- und verurteilt, verdammt, klassifiziert, zur Aufgabe gezwungen und einer gewissen Lebens- oder einer gewissen Sterbensweise geweiht" (ebd.). In sozialfunktionaler Sicht werden aus Wahrheitskriterien (analytisch notwendig) Mittel der Herstellung und der Sicherung von Machtbeziehungen. [125]
Die semantische Denkform bietet neben solchen sozialen Funktionalisierungen aber auch noch die Möglichkeit der individualen Funktionalisierung des Konstrukts Willensfreiheit. Es stellt sich dann die Frage: Welche Funktion erfüllt dieses Konstrukt einem Menschen im Verweisungszusammenhang seiner individuellen Lebensführung? Ist es vielleicht identitätsfunktional? Derart individualfunktional befragte sich etwa Sigmund FREUD (1964), als er zu ergründen suchte, warum die "Anerkennung eines Aggressionstriebs" (S.110) auch bei ihm selbst so zögerlich vonstatten gegangen sei. Er passt wohl nicht, so meinte er, zum Bild, das der Mensch sich von sich selbst zu machen wünsche. Vergleichbares könnte für die "Vierte Kränkung der Menschheit" gelten, für das Annehmen der Tatsache, dass die Willensfreiheit eine Illusion ist. Dagegen wird Widerstand geleistet durch das Beibehalten des Konstrukts der Willensfreiheit. So kann der Mensch seinem ihm liebgewordenen Selbstbild weiterhin frönen. [126]
|
Ergänzung Ein vergleichbares, aber funktional anders zentriertes, individualsemantisches Erklärungsmuster liefert METZINGER in einem Interview (in Süddeutsche Zeitung, 5.8.2003), betitelt: "Das Ich ist eine Illusion": Das "Ich" ist "ein inneres Bild von sich selbst" oder ein "Selbstmodell". Ihm ist der "hartnäckige Eindruck (eigen), dass es einen Kern gibt, etwas, das über die Zeit hinweg identisch bleibt". Dieses Modell und diese Eigenart sind da, weil sie einen Zweck erfüllen: "Zweck dieses Modells ist es, sich in der äußeren Welt zu orientieren, mit anderen bewussten Wesen zu kommunizieren und Aufmerksamkeit und Denken auf sich selbst als Ganzes lenken zu können. ... (Das Modell) ist ... eine geschickte Art, den Informationsfluss zu organisieren" (ausführlicher in METZINGER, 2003). Das "Ich" illusioniert METZINGER, indem er auf das Gehirn, auf seine physische Beschaffenheit und auf die physische Eigenart der Umwelt des Gehirns hinweist. Aus dieser Realität ist das "Ich", wie oben dargelegt, definitorisch "entfernt" (SCHRÖDINGER, 1989) worden (deshalb ist das "Ich" in ihr eine "Illusion"). Nun wechselt METZINGER den Realitätsmodus, indem er folgendermaßen argumentiert. Die Zweckbestimmung des illusionären "Selbstmodells" verankert er jetzt in (mentalistisch-)semantischen Bezügen (Orientierung, Information, Aufmerksamkeit, Kommunikation). Diese Zweckbestimmung wird evolutionär hergeleitet. METZINGER liefert somit etwas, das VINE (1983) eine distal-funktionale Erklärung nennt. Und in dieser spezifiziert METZINGER den "Zweck" als individualfunktionalen (das "Selbstmodell" ist individuell orientierungsdienlich). Also auch hier: Das "Ich" gibt es nicht (weil es physisch inexistent ist), aber als mentale Illusionsgröße erfüllt es eine brauchbare individual-pragmasemantische Funktion. Es ist eigenartig, dass das "Ich" in einem evolutionären Argumentationszusammenhang zur "Illusion" erklärt wird, denn zur Evolutionstheorie gehört doch eigentlich, dass das, was unter der Ägide der Evolution entstanden ist (z.B. die Reißzähne der Raubkatzen) auch real existiert. Das "Ich" dürfte dann keine "Illusion", sondern müsste eine Realität sein (aber das darf wohl nicht sein, weil alle Realität ausschließlich physischer Natur ist, und das "Ich" übersteht die Zugehörigkeitsprobe nicht). [127] |
Innerhalb sozial- und individualsemantischer Zusammenhänge lässt sich aber auch noch eine ganz andere Frage aufwerfen: Warum hat die "Willensfreiheitsdebatte" eine so breite massenmediale Resonanz (in Zeitungen, auf dem Buchmarkt, im Rundfunk und im Fernsehen, in Vorträgen) erfahren? Eine sozialfunktionale Hypothese könnte so lauten: Das Thema Willensfreiheit erfüllt in seiner neurowissenschaftlichen Fassung einige wichtige Voraussetzungen massenmedialer Wirksamkeit. Es ist einfach zu verstehen, es ist eindrücklich darstellbar (z.B. durch ein bunt gemustertes PET-Bild), es ist spektakulär und es trägt bei alledem noch den Mantel wissenschaftlichen Nachweises. Die vermeintliche wissenschaftliche Falsifikation der Willensfreiheit gehört zu jener Gruppe wissenschaftlicher Erkenntnisse, die den Menschen ein, um es bayerisch zu sagen, "Joa, gibt's des aa!" entlocken. Solche verblüffenden Befunde, das weiß jeder, der unterrichtet, werden besonders aufmerksam aufgenommen, sie werden begierig diskutiert und kaum mehr vergessen. [128]
Eine letzte sozialfunktionale Hypothese betrifft die Funktionalität neurowissenschaftlicher Erklärungsverheißungen innerhalb des sozialen Prozessierens von Forschungspraxis. Was ich damit ansprechen will, mag ein Vergleich deutlich machen: Max EINHÄUPL (2002), zurzeit Vorsitzender des Wissenschaftsrats, hat einmal beklagt, dass Forscher, um sich im Kampf um knappe Ressourcen marketingtaktisch gut aufzustellen, Versprechen machen, die weit jenseits dessen liegen, was sie wirklich geleistet haben und aktuell zu leisten in der Lage sind:
"Seit ich Mediziner bin, verspricht man in Forschungsanträgen neue Gentherapien. Aber nennen Sie mir einen einzigen Bereich, in dem eine Gentherapie funktioniert. Ich rate den Wissenschaftlern dazu, der Gesellschaft nicht immer Dinge in Aussicht zu stellen, die sie auch nicht in absehbarer Zeit erfüllen können" (in: Die Zeit, 14. Nov. 2002). [129]
Die Erkenntnisverheißungen mancher Neurowissenschaftler stehen, was ihren Begründetheitsgrad anbelangt, denen mancher Molekulargenetiker in nichts nach. Und die forschungspolitischen Zwecke liegen vergleichbar auf der Hand (vgl. dazu auch LAUCKEN, 2001). Sie passen sich ein in "eine gewisse Ökonomie der Wahrheitsdiskurse" (FOUCAULT, 2003, S.233), deren Produkte die "vielfältigen Machtbeziehungen" (ebd.) des gesellschaftlichen Zusammenlebens grundlegen. [130]
Um aus solchen Funktionalisierungen, ich habe hier absichtlich deren mehrere angetippt, keine falschen Schlüsse zu ziehen, sei ein Kommentar des Philosophen Nicolai HARTMANN (1962) angefügt, den er funktionalen Deutungen religiöser Glaubensinhalte gegenüber äußerte: Die Tatsache, dass die Vorstellungen vom himmlischen Paradies sehnlichsten Wünschen der Menschen entgegenkommen, sagt nichts darüber aus, ob es das Paradies gibt oder nicht. [131]
Nach diesem Einschub möchte ich zurückkehren zu der Frage nach den Möglichkeiten der Vergegenständlichung der Willensfreiheit als einer Realität in den Realitätsentwürfen verschiedener psychologischer Denkformen. [132]
4.7 Die phänomenale Denkform und ihr Gegenstandsmodus
Auch hier sei wieder an das Ausgangsbeispiel (vgl. 4.2) angeknüpft. Ein Psychotherapeut, der einen Klienten in der phänomenalen Denkform vergegenständlicht, fragt nach seinem erlebend-gelebten In-der-Welt-Sein. Alltagspraktisch ist uns diese Vergegenständlichung überaus geläufig. Vor allem, wenn ein Mitmensch sich irgendwie sonderbar verhält, fragen wir uns, in welcher Welt dieser Mensch wohl lebe. Sie muss wohl anderer Art sein als die unsere, denn sonst erschiene uns sein Verhalten nicht so sonderbar. Derartige Fragen zielen genau auf jenen Gegenstandsentwurf, der die phänomenale Denkform konstituiert. Es ist dies ein Gegenstandsentwurf, der es erlaubt, den Lebensvollzug von Mitmenschen zu verstehen. [133]
Diesen Gegenstandsentwurf zu explizieren, ist einfach und schwierig zugleich (ausführlich in LAUCKEN, 2003a). Es ist einfach, weil man schlicht auf die Realität verweisen kann, die allen Menschen als einzige in ihrem unmittelbaren Lebensvollzug gegeben ist – "immediately given to the experiencing person" (KUIKEN, SCHOPFLOCHER & WILD, 1989, S.374). Sie ist der Gegenstand phänomenalen Forschens: "Phenomenal description ... is directed immediately toward experience phenomena ... All these phenomena are taken as they belong to the phenomenal world" ( BUYTENDIJK, 1967, S.259). Ins Reich des Erfahrens gehört dabei auch das Erfahren der Welt, die uns umgibt: "the way things present themselves to us in and through ... experience" (SOKOLOWSKI, 2000, S.2). Die phänomenale Realität insgesamt umfassend lässt sich sagen: "The world, in phenomenology, encompasses in effect the whole universe, and objects are not only material things but include thoughts, ideas, emotions, concepts etc." (DANCE, 2000, S.70, Fußnote). [134]
Den Gegenstandsentwurf zu explizieren ist schwierig, weil es uns wissenschaftlich ungewohnt ist, ihn in abgehobener Eigenständigkeit zu begreifen. In wissenschaftlichen Erörterungszusammenhängen wird oftmals versucht, ihn mittels anderer Gegenstandsentwürfe irgendwie zu vereinnahmen:
Manche Wissenschaftler, vor allem Neurowissenschaftler, erklären schlicht (ich sprach darüber), die phänomenalen Lebensgegebenheiten seien Eigenschaften physischer Zustände und Vorgänge, vergleichbar den elektrischen Qualitäten derselben (vgl. ROTH, 1997). Folglich verdienen sie keine eigenständige Denkform.
Andere Wissenschaftler, wiederum vor allem Neurowissenschaftler, sprechen vom phänomenalen Erleben als kausal irrelevantem korrelativem Beiwerk. So spricht NEWTON (2001) von einem "experiential correlate of neural binding through synchronized firing or re-entrant loops" (S.49). Kausal irrelevantes phänomenales Beiwerk in sich zu erforschen, ergibt wenig Sinn.
Wieder andere Wissenschaftler, häufig kognitiv-informationsverarbeitungstheoretisch orientierte, lassen das phänomenale Bewusstsein in ihren Theorien sich dann einschalten, wenn ein Organismus in seinen routinisierten Lebensvollzügen gestört wird, etwa in einem Bewegungsvollzug: "Motor phenomenology ... is consciousness of delay and discrepancy and without it a subject would not be conscious of herself as a motile agent" (Gerrans, 2003, S.511). Solche Störreiz-Modelle des phänomenalen Bewusstseins tauchen in verschiedenen Abwandlungen auf, auch in diversen kognitiven Informationsverarbeitungstheorien (vgl. z.B. LINDSAY & NORMAN, 1973). Durch eine Vollzugsstörung auf einer Informationsverarbeitungsebene werden übergeordnete (nun phänomenal gegebene) Informationsverarbeitungsebenen aktiviert, die die Störung auf der unteren Ebene bearbeiten (vgl. auch JEANNEROD, 1997). [135]
Wissenschaftler, die so vorgehen, glauben durch solche Unterbringungen phänomenaler Gegebenheiten, die Notwendigkeit der Setzung einer eigenen phänomenalen Denkform, die ihren eigenen Gegenstand hat, erübrigen zu können. [136]
Gegen solche Vereinnahmungsversuche hilft die oben erläuterte "Ohne anders?"-Probe. Verlaufen elektrochemische Prozesszusammenhänge im Gehirn anders, abhängig davon, ob ihnen phänomenale Qualitäten zukommen oder nicht? Lässt sich eine Antwort nicht gegenständlich fixieren und bearbeiten, dann ist der Vereinnahmungsanspruch nichtig. Für die physische Denkform habe ich dies bereits erörtert. Für die semantische Denkform gilt es, dies noch zu leisten, was ich hier recht überschlägig tue. [137]
Kognitionstheoretiker oder Informationsverarbeitungstheoretiker behaupten in der Regel nicht, dass phänomenale Qualitäten zusätzliche Eigenschaften bestimmter kognitiver Informationsverarbeitungsvorgänge sind. Sie sagen eher, dass es sich bei phänomenalen Gegebenheiten um Informationsverarbeitungsvorgänge handelt, die bestimmte Leistungen vollbringen. Deren Erbringen sei an Bewusstheit (oder auch "awareness") gebunden. Diese bewusstseinsbedürftigen Verarbeitungsvorgänge sind es sodann, die den phänomenalen Kosmos, den ein Mensch erlebend lebt, ausmachen. [138]
Schaut man sich die kognitiven Informationsverarbeitungstheorien, die das phänomenale Sein derart einzufangen versuchen, daraufhin an, wie die bewussten Bereiche des Informationsverarbeitungssystems fungieren und was sie erbringen, so stößt man auf Verschiedenartiges: auf Vorgänge der Selbstreferenz, auf Vorgänge metakognitiver Art, auf Vorgänge intellektueller Handlungsregulation, auf Vorgänge, die sich in Arbeitsspeichern begrenzter Verarbeitungskapazität abspielen, auf Vorgänge der Aufmerksamkeitszentrierung und anderes mehr (vgl. LAUCKEN, 2003, S.298ff.). All dies sind aufschlussreiche Vorgänge, die sich in der Aufgabenarchitektur eines kognitiven Informationsverarbeitungssystems irgendwo, vielleicht gar an zentralen Stellen, einbauen lassen. Auf sie bezogen lautet die "Ohne anders?"-Probe nunmehr so: Kann das skizzierte Informationsverarbeitungssystem nicht haargenau so ablaufen, wie es das Verarbeitungsprogramm vorsieht, ohne dass bestimmte Bereiche phänomenal gegeben sein müssen? Müssen in der Verarbeitungsarchitektur höherrangige Verarbeitungsprozesse phänomenal gegeben sein, um als solche fungieren zu können? Müssen metakognitive Vorgänge phänomenal gegeben sein, um das zu leisten, was sie sollen? Müssen die Inhalte des Arbeitsgedächtnisses phänomenal gegeben sein, damit das Arbeitsgedächtnis als solches prozessieren kann? ... und so weiter. Wer so fragt, wird rasch zu dem Schluss kommen, zu dem HERRMANN (1988) im Blick auf die KI-Forschung kam: "Die KI-Forschung und weite Teile des psychologischen Informationsverarbeitungsansatzes brauchen diesen Terminus (den des Phänomenalen; U.L.) nicht" (S.174), denn das Bewusstsein (als möglicher Sitz des Phänomenalen) imponiert in diesen Theorien nicht durch seine Phänomenalität, sondern durch seine besonderen Verarbeitungsleistungen, die es in dem Informationsverarbeitungssystem zu erbringen hat. Ich verschärfe HERRMANNs Aussage noch, indem ich aus ihr die Passage "weite Teile" streiche. Die "Ohne anders?"-Frage muss verneint werden. Damit ist der Versuch, phänomenales Sein im Gegenstandsentwurf der semantischen Denkform unterzubringen, gescheitert – hier exemplarisch demonstriert am Beispiel so genannter kognitiver Informationsverarbeitungstheorien. Ich hätte in gleicher Weise auch psychologische und/oder soziologische Handlungstheorien herausgreifen können. [139]
|
Ergänzung Es bleibt dabei. Worüber bereits Charles DARWIN staunte, darüber müssen auch Theoretiker der physischen und der semantischen Denkform staunen. DARWIN war nämlich nicht klar, welchen zusätzlichen Überlebensvorteil es erbringen sollte, wenn sich zu bestimmten organischen Leistungen (die sich physisch oder semantisch vergegenständlichen lassen) deren phänomenale Gegebenheit hinzugesellte ("superadded" sagte DARWIN in einem Brief; vgl. GRUBER & BARRETT, 1974, S.420). So kann denn auch Konrad LORENZ (1968) darüber räsonieren, ob "Tiere ein subjektives Erleben" (Titel) haben, ohne dass eine Antwort darauf für seine biologischen Theorien von Belang wäre. Besser lässt sich die "Ohne anders?"-Probe nicht demonstrieren. CARPENTER (1996) kann somit feststellen, dass aus neurophysiologischer Sicht das phänomenale Bewusstsein für die Steuerung motorischer Reaktionen kausal irrelevant ist. Gleiches gilt für kognitiv-informationsverarbeitungstheoretisch ausgelegte Ansätze. Und selbst dann, wenn es COTTERILL (2001) gelänge, zu belegen, dass das phänomenale Bewusstsein denen, die es besitzen, einen adaptiven Vorteil zu liefern vermag, so dass das Entstehen des phänomenalen Bewusstseins einer evolutionären Logik folgte, so bliebe weiterhin die Tatsache erhalten, dass das phänomenale Sein in den Gegenstandsentwürfen der physisch-biologischen und der semantisch-informationstheoretischen Denkformen ein gegenständlicher Fremdkörper bleibt, der sich durch die "Ohne anders?"-Probe leicht entdecken lässt. Es bleibt dabei. [140] |
Also: Die Vereinnahmungsgelüste der physischen und der semantischen Denkform scheitern an der "Ohne anders?"-Probe, die sich freilich nur auf die erkenntnisgegenständliche Unterbringung bezieht. Als Erkenntnismittel sind die phänomenalen Gegebenheiten dagegen sowohl in der physischen wie auch in der semantischen Denkform unverzichtbar. Relativ zu dem Erkenntnisgegenstand sind sie dann aber, wie ich es oben bei der physischen Denkform erläutert habe, deobjektiviert und indikatorisiert. [141]
Aus all diesen Um- und Verschlingungsversuchen tritt nun ein eigenständiger Kosmos hervor, der sich abstrakt so bestimmen lässt:
Es gibt eine phänomenale Realität. Diese ist das erlebend-gelebte In-der-Welt-Sein je einzelner Menschen. Diese phänomenale Welt ist gegliedert und geordnet. Solche Ordnungen verändern sich in der Zeit. Veränderungen sind sinnkausal bewirkt. [142]
Damit ein Kosmos erforschbar ist, muss er ein eben solcher sein (und kein Chaos). Ihm muss, wie in der Bestimmung ausgesagt, eine erkennbare gegenständliche Ordnung innewohnen. Welcher Art diese ist, lässt sich einem Zitat Hermann LÜBBEs (1972) entnehmen: "Die Lebenswelt (die phänomenale Realität; U.L.) meint ... die subjektive Totalität jener praktisch-sinnerfüllten Wirksphäre, der der Mensch niemals in monadischer Isolierung gegenübersteht, die er vielmehr in seinem konkreten Dasein ist" (S.76). Dies äußert LÜBBE in einem Buch, das er "Bewusstsein in Geschichten" nennt. In ihm referiert er unter anderen Wilhelm SCHAPP. Von diesem stammen etwa folgende Sätze:
"Wer uns (Menschen; U.L.) verstehen will, der muss eine ... Geschichte bereithalten, eine Geschichte um Liebe, Leben, Ehre, Besitz, Rache ..." (SCHAPP, 1959, S.3). "(D)ie Geschichte (als Ordnungsfigur; U.L.) ist der letzte in sich verständliche Teil eines mit ihm auftauchenden ungeschlossenen Ganzen, welcher die Frage der Verstehbarkeit in sich führt" (ders., 1976, S.146).
"Auch Gefühlsregungen ..., Freude, Trauer, Liebe, Hass tauchen nur in Geschichten auf, in Geschichten, in die wir verstrickt sind" (S.148). Gefühle sind "immer nur Momente an Geschichten" (S.149). "Den Ursprungsort, an dem uns Liebe und Hass, Freude und Trauer und alle so genannten Gefühlsregungen begegnen, bilden Geschichten, in die wir als Ich oder als Wir verstrickt sind ..." (ebd.). [143]
Abstrahiert man über all diese beispielhaften Aussagen hinweg, so lässt sich sagen, dass Menschen in phänomenaler Vergegenständlichung stets in irgendeiner narrativen (oder geschichtenförmigen) Sinnordnung leben: "(T)he structure of experience itself, is exactly narrative. Experience is put together like a story. Experience has a narrative structure ..." (KEEN, 1986, S.176). Das phänomenale In-der-Welt-Sein von Menschen oder ihr lebensweltliches Dasein oder ihr erlebend-gelebtes Leben (und andere Bezeichnungen mehr) ist jeweils narrativ oder geschichtenförmig artikuliert und strukturiert, und zwar subjektiv sinnhaft. Im Zentrum solcher Sinnordnungen steht kein Ich, das diese Ordnung hat, sondern ein Ich, das als ein in eine Sinnordnung verstricktes existiert. Existenziell verstrickt ist es durch sein Handeln, sein Denken, Fühlen und Wollen, durch seine Bezüge zu Mitmenschen und so weiter. All dies taucht jeweils als ein Moment einer bestimmten narrativen Sinnordnung auf. [144]
Erkenntnisziel der Forscher, die Menschen in der phänomenalen Denkform vergegenständlichen, mag es sein, Grundstrukturen narrativer Ordnungen, die Menschen leben, zu erfassen. Erkenntnisziel ist dann der Plot, der als narratives Leerstellengefüge bestimmten Bereichen einer erlebend-gelebten Lebensführung als sinngebende Ordnung zugrunde liegt. So mag sich ein Psychotherapeut dafür interessieren, ob den geschilderten, vielleicht konkret unterschiedlichen, vielleicht wiederkehrenden und angstbesetzten Lebenssituationen, derentwegen ein Klient ihn aufsucht, ein gemeinsamer Angst-Plot zugrunde liegt, dessen Leerstellengefüge sich situativ unterschiedlich spezifiziert – z.B. Angst in Situationen, in denen Aufgaben gestellt werden, die alleine und eigenverantwortlich zu meistern sind. [145]
Die phänomenale Denkform ist durch ihren Gegenstandsentwurf bestimmt, "not by any particular method of gaining access to this object of investigation" (BRADDOCK, 2001, S.3). Schon gar nicht ist sie durch irgendwelche "introspektiven" Methoden bestimmt. Die meisten phänomenal forschenden Wissenschaftler lehnen die Introspektion als geeignete Methode ausdrücklich ab. Es gibt vielfältige und unterschiedlichste andere Methoden einer "indirect phenomenology" (ders., S.5). Wie in allen Denkformen ist die erkenntnissemantische Rubrik der Erkenntnismittel oft ein Sammelbecken verschiedenster Zugriffe, ständig werden neu Möglichkeiten eingeführt und durchdacht und andere, bislang verwendete, werden kritisiert und verworfen. [146]
|
Ergänzung Natürlich steht es einem frei, die gegenständliche Setzung einer eigenen phänomenalen Welt zu hinterfragen oder sie gar abzulehnen, etwa indem man die Frage eines Neurowissenschaftlers: "(A)re there objective criteria of subjective awareness?" (VANDERWOLF, 1998, S.125) aufwirft und sie sodann verneint. Aber man mache sich dann nichts vor. In gleicher Weise ließen sich "Raum, Zeit und Masse" oder beispielsweise "Information" befragen. Auf die Frage, ob Physiker denn inzwischen wüssten, "was Zeit eigentlich ist", antwortet der Physiker GREEN (2004): "Letztlich nicht. Schon Newton kämpfte um eine Definition. ... Er sagte: 'Zeit ist, und sie tickt gleichmäßig von Moment zu Moment'" (S.190). Auch für die Es-gibt-Setzungen der Physiker (aber auch für die der Informatiker; vgl. z.B. CLAUS, 1986, S.242) gibt es keine "objective criteria", die gleichsam von einer unbezweifelbaren Außenwarte einen wissenschaftlichen Objektivitätsstatus sichern. Das einzige "Von-Außen", das allen diesen Entwürfen gemeinsam ist, ist der "gesunde Menschenverstand" mit seiner Begrifflichkeit. So sagt denn auch Werner HEISENBERG, die einzige Metasprache aller Wissenschaftssprachen ist die Umgangssprache. Ich kann hier nur nochmals an SCHRÖDINGER (1989) erinnern und Analoges für die Setzung eines phänomenalen und eines semantischen Kosmos beanspruchen. Der Gegenstandsentwurf der Naturwissenschaften (z.B. EDDINGTONs "Schattentisch", s.o.) ist das Ergebnis gegenständlicher Setzungen (oder Postulate). Und die Setzung einer physischen Realität im Sinne der modernen Naturwissenschaften ist keineswegs eine Setzung, die uns unser Umgangswissen oder unsere unmittelbare Welterfahrung gleichsam evident nahe legt oder gar aufdrückt, denn sonst wäre es unerklärlich, warum die physische Realität (in ihrer modernen Fassung) ihren Status als objektive Gegebenheit erst im 17. Jahrhundert erhielt und zwar gegen den Widerstand vermeintlich evidenten alltagspraktischen Erfahrens und Wissens (vgl. CASSIRER, 1980, S.46). [147] |
4.8 Ermöglichungsbeziehungen zwischen den Gegenstandsentwürfen verschiedener Denkformen und "Wie-ist-es-möglich?"-Fragen
Sich die verschiedenartigen Gegenstandsentwürfe mit ihren differenten Realitätsmodi zu vergegenwärtigen, ist nicht nur für klares Denken wichtig, es macht auch erkenntnisbescheiden und verhindert Usurpationsgelüste. Jede Denkform hat ihre Leistungen und ihre Begrenzungen. Innerhalb der physischen Denkform mag es gelingen, z.B. Hörgeräte zu konstruieren, eine Leistung die außerhalb der praktischen Reichweite der semantischen Denkform liegt. Innerhalb der semantischen Denkform mag es gelingen, z.B. Regeln und Verfahren effektiven wissenschaftlichen Problemlösens zu entwerfen, eine Leistung, die außerhalb der praktischen Reichweite der physischen Denkform liegt. Innerhalb der phänomenalen Denkform mag es gelingen, z.B. zu verstehen, in welcher subjektiven Welt ein jugendlicher Gewalttäter lebt, wenn er seine Taten vollbringt. Der physischen Denkform wäre dieses Erkenntnisziel gegenständlich verschlossen ... und so ließe sich fortfahren. Aus all dem ergibt sich, dass es borniert und dumm wäre, schriebe man allein einer Denkform wissenschaftliche Legitimität zu. Eine jede Denkform und die ihr zugehörige Praxis haben ihre eigenen Leistungen und Grenzen. Worüber nachzudenken sich aber lohnt, ist, ob sich zwischen den denkformspezifischen Gegenstandsentwürfen transversale Beziehungen herstellen lassen. Dabei stoßen wir auf ein Problem. [148]
Die drei unterschiedenen Gegenstandsentwürfe sind eigene gegenständliche Totalitäten, jeweils in sich kausal geschlossen. Dies ist so, weil die Denkformen so konzipiert sind, wie sie es sind (man denke an das konstitutive Ausschließungsprinzip der physischen Denkform). Zwischen den einzelnen gegenständlichen Totalitäten lassen sich daher keine kausalen Übersprungbeziehungen der Art "Ende hier (z.B. in der Welt des Phänomenalen mit einer Absicht X), Anfang dort (z.B. in der physischen Welt mit einer elektrischen Entladung Y in einem bestimmten Nervenverband)" herstellen, wohl aber lassen sich zwischen verschiedenen gegenständlichen Totalitäten "Wie-ist-es-möglich?"-Fragen stellen (vgl. LENK, 2001). Solche Fragen thematisieren denkbare ontische Modalbeziehungen zwischen den Gegenstandsentwürfen unterschiedlicher Denkformen. [149]
|
Ergänzung In solchen Ermöglichungsbezügen zu denken, ist uns allen durchaus geläufig. Ein paar Beispiele mögen dies belegen:
Das mag an plausibilisierenden Beispielen genügen. Ihnen allen ist evident zu entnehmen, dass auch eine gegenständlich noch so differenzierte Analyse der ermöglichenden Größen nicht das zutage förderte, was die ermöglichten Größen gegenständlich beinhalten. So wird auch eine noch so detaillierte physikalische Erfassung der Kreidespuren an der Wandtafel, der Biomechanik ihrer körperbewegenden Erstellung und deren neuronaler Erregung und so weiter nicht ergeben, welche mathematische Ableitungsfolge der Lehrende zum Ausdruck bringt und ob diese in sich schlüssig ist oder nicht. Aus all dem ergibt sich, dass Ermöglichungsbeziehungen nicht als Ersetzungsbeziehungen taugen. In der Geschichte der Psychologie gab es immer wieder Bestrebungen, programmatisch folgende Maßgabe zu setzen: "The theoretical importance of psychological description ... derives almost exclusively from the light they throw on physiological mechanisms" (PRATT, 1939, S.ixf.). Dahinter stand die Idee, dass ein (weiches) psychologisches Erklären sich irgendwann durch ein (hartes) physiologisches Erklären ersetzen lasse. Doch der Sinn solcher Maßgaben und Zielsetzungen wurde auch immer wieder gründlichem Zweifel unterzogen, z.B. durch ein Argument folgender Art: "These (z.B die physiologischen, U.L.) concepts presuppose ... the notion of mass and substance, which has no meaning as far as consciousness is concerned" (PIAGET, 1968, S.187). Und PIAGET gibt dann folgendes Beispiel: Mit 2 + 2 = 4 ist eine Implikationsbeziehung gemeint, die sich nicht äquivalent ersetzen lässt durch irgendwelche physiologischen Beziehungen. Anders steht es um Ermöglichungsbeziehungen. Es spricht nichts dagegen, zu fragen und zu erforschen, welche Gehirnareale aktivierbar sein müssen, damit ein Mensch 2 + 2 = 4 rechnen zu kann. [150] |
Wie man sich das (transversale) ontische Ermöglichungsverhältnis zwischen ermöglichenden und ermöglichten Größen vorstellen soll, dazu lassen sich vielerlei Theorien bilden. Es gibt schichtenanaloge Ermöglichungstheorien. Das Ermöglichte (z.B. eine Information) ist ein Getragenes, das Ermöglichende (z.B. ein neuronaler Vorgang) ist ein Tragendes. In lateinischer Ausdrucksweise wird oft von einer Substratbeziehung gesprochen. Es gibt stützungsanaloge Ermöglichungsbeziehungen. Das Ermöglichungsverhältnis ist dann ein ermöglichungskomplementär wechselseitiges. So mögen neuronale Größen semantische ermöglichen, welche wiederum die besondere Eigenart der neuronalen ermöglichen. [151]
Intensiv diskutiert und forschungsthematisch genutzt wird die Annahme formaler Strukturanalogien (oder Ordnungsentsprechungen) zwischen gegenständlich differenten Zusammenhängen. Theoriegeschichtlich vertraut sind den Psychologen die gestaltpsychologischen Annahmen über Feldstrukturen, die sich isomorph (gestaltgleich) in psychischen (phänomenalen) und physiologischen (physischen) Zusammenhängen finden lassen. [152]
Wenn man von Strukturanalogien spricht, muss man natürlich über eine formale Struktursprache verfügen. MC INTOSCH, FITZPATRICK und FRISTON (2001) suchen nach mathematischen Modellen, mit denen sich kognitive und neuronale Prozesse analog modellieren lassen. Manche Theoretiker glauben, in dem formalen Modell der so genannten neuronalen Netzwerke ein mathematisches Modell gefunden zu haben, welches dies leistet (vgl. z.B. WASSERMAN, 1989). In bislang vorliegenden empirischen Studien (vgl. z.B. OCHSNER & LIEBERMANN, 2001) werden meist topologische Strukturanalogien herangezogen und erforscht. Im schlichtesten Falle geht es dann beispielsweise darum, ob etwas, das semantisch getrennt wird (z.B. verschiedene Gedächtnisarten), auch physisch getrennt ist (z.B. lokalisiert in verschiedenen Gehirnarealen). So folgern etwa SANDERS, MC CLURE und ZÁRATE (2004) aus dem Befund, dass "person-based learning in the right hemisphere (lokalisiert ist) and group-based learning in the left hemisphere" (S.279), dass beiden Arten sozialer Urteilsbildung unterschiedliche "encoding mechanisms" (ebd.) zugrunde liegen. Oder man kann aus der Tatsache, dass bei semantischen Prozessen, die auf Grund ihrer theoretischen Erfassung getrennt werden (z.B. Prozessieren von Vorurteilen, Prozessieren von Bewertungen, Prozessieren von Stimmungen), dieselben neuronalen Strukturen aktiviert sind (z.B. indiziert durch Daten bildgebender Verfahren), folgern, dass diesen Prozessen vielleicht auch etwas semantisch-prozessual Einheitliches zugrunde liegt, nach dem man suchen sollte. So folgert etwa EPSTEIN (2000) aus der Beobachtung, dass bei räumlichen wie bei begrifflichen Orientierungsaufgaben das gleiche neuronale System aktiviert ist, dass das (gedankliche) "Begreifen" nicht nur bedeutungsgeschichtlich etwas mit dem (manuellen) "Greifen" zu tun hat – was ja bereits Jean PIAGET (1947) unterstellt hat. [153]
|
Ergänzung Eine klassische Fragestellung, welche die Idee der Strukturanalogie thematisiert, ist das von HORGAN (1999) so genannte Humpty-Dumpty-Dilemma. SCHRÖDINGER (1989) behandelte es unter der Überschrift "Das arithmetische Paradoxon. Die Einheit des Bewusstseins" (S.77ff.). Es gibt demnach eine paradoxe Strukturdifferenz. "Niemand von uns hat je mehr als ein einziges Bewusstsein erlebt, und es gibt auch nicht die Spur eines Indizienbeweises, dass dies je in der Welt stattgehabt hätte" (S.81). Und: "Ich kann mir durchaus nicht vorstellen, wie mein einheitliches und als einheitlich empfundenes Bewusstsein durch eine Integration der Bewusstseine der Zellen, die meinen Leib bilden (oder einiger von ihnen), entstanden sein sollte oder wie es in jedem Augenblick gleichsam ihre Resultante sein sollte. Ein solcher Zellenstaat, wie jeder von uns es ist, wäre doch für das Bewusstsein geradezu die gegebene Gelegenheit, eine Vielfalt zu manifestieren, wenn es dazu überhaupt fähig wäre" (S.83f.). "Materie und Energie scheinen eine körnige Struktur zu haben, und das (biologisch gefasste; U.L.) Leben gleichfalls, aber nicht der Geist" (S.89). In zeitgemäßerem Sprachgewand lautet das Problem so: "The problem of mental unity poses a real challenge for any neurobiological theory of mind. If all brain regions that contribute to consciousness can be enumerated and tallied as if they were computer modules, how are they integrated so that we exist as unified, single selves? What is it about the brain that creates the subjective sense that we possess a single and unified point of view, an inner 'I'?" (FEINBERG, 2001, S.124). Das Humpty-Dumpty-Dilemma bzw. das Arithmetische Paradox ist lediglich dann ein solches, wenn man annimmt, dass es zwischen dem physisch-neuronalen und dem phänomenalen Sein strukturelle Analogien geben müsste. Um das Dilemma/Paradox zu lösen schlägt übrigens FEINBERG vor, die neuronale Struktur des Gehirns anders zu fassen als es SCHRÖDINGER wohl tut. Die neuronalen Zellen bilden, so schlägt FEINBERG vor, untereinander ein "nested system" (S.134). Es ist dies eine Einschluss-Ordnung. Sie besteht aus Verhältnissen des Ineinander und nicht des Nebeneinander ("non-nested" oder Anschluss-Odnung). Eine Einschluss-Ordnung ist eine, die als oberste Ordnungsstufe eine alles umfassende Einheit besitzt. Diese könnte dann der Einheit des Bewusstseins strukturell analog sein. [154] |
Es ist festhaltenswert, dass in ermöglichungstheoretischen Denkbezügen die einzelnen ontischen Totalitäten als eigene Realitäten erhalten bleiben, in welche ermöglichenden Bezüge auch immer sie gestellt werden mögen. So bleibt etwa ein Gedicht als Text auch dann eine semantische Gegebenheit, wenn gezeigt werden kann, dass es als physische Gegebenheit aus Tintepartikeln besteht, die einem komplizierten geometrischen Muster folgend auf dem Papier, an dem sie haften, verteilt sind ... und so weiter, selbst wenn weiterhin unstrittig ist, dass das Gedicht auf diese (oder eine andere) physische Verkörperung unabdingbar angewiesen ist. Ermöglichungstheoretisches Denken mündet nie in ein "Nichts-anderes-als"-Denken (wie ich es oben beispielhaft zitiert habe; vgl. CRICK, 1997, S.17). [155]
Und ein Weiteres ist festzuhalten: Aufschlussreiche ermöglichungstheoretische Untersuchungen verlangen nach einer jeweils ausgiebigen und gründlichen Erfassung der ontischen Konstellationen, die aufeinander bezogen werden sollen. So fordert BRADDOCK (2001) "a systematic and sophisticated phenomenological account of consciousness" (S.4), bevor man sich anschickt, "Wie-ist-es-möglich?"-Fragen zu stellen, etwa solche nach ermöglichenden neuronalen Zuständen und Vorgängen. BRADDOCK wendet sich so gegen Schrumpf-Phänomenologien etwa von Schlage der "Neurophenomenology" eines VARELA (1996). [156]
5. Denkformen und ihre Möglichkeiten, Willensfreiheit zu vergegenständlichen
Nachdem drei Denkformen und die sie charakterisierenden Gegenstandsmodi expliziert worden sind, lässt sich die eingangs gestellte gegenständliche Unterbringungsfrage wieder aufgreifen und beantworten. Ich hoffe, dass sich nun zeigen wird, warum es notwendig gewesen ist, so ausführlich über die einzelnen Denkformen zu reden. Jetzt soll die Ernte dieser Arbeit insofern eingefahren werden, als die Vergegenständlichungsfrage nun klar gestellt und beantwortet werden kann. [157]
5.1 Willensfreiheit und die physische Denkform
Zunächst will ich untersuchen, welche Möglichkeiten die physische Denkform bietet, um die Willensfreiheit irgendwie erforschungsrelevant unterzubringen. Wenn es, wie ROTH (2004a) sagt, darum geht, zu klären, ob es die Willensfreiheit als eine reale Größe überhaupt gibt, dann muss die Willensfreiheit zunächst als solche Größe potenziell irgendwie gleichsam dingfest gemacht werden können. Erst wenn einem dies gelungen ist, lässt sich die Existenz-Hypothese wissenschaftlich sinnvoll stellen. Folglich gilt es zunächst zu fragen, wie die Willensfreiheit als reale Größe fixiert werden kann, und zwar zunächst hypothetisch, um dann (empirisch) feststellen zu können, ob es diese Größe gibt oder nicht gibt. [158]
5.1.1 Willensfreiheit als erkenntnisgegenständliche Größe im physischen Kosmos
Jede Denkform rankt sich um eine gegenständliche Behauptung: Das gibt es! Das kann erforscht werden! Wenn ROTH, SINGER, DAMASIO, CRICK und andere Neurowissenschaftler ihr Erkenntnisstreben innerhalb der physisch-naturwissenschaftlichen Denkform entfalten (CRICK, 1997, spricht von der "naturwissenschaftlichen Erforschung des Bewusstseins"), dann ist ihre Aussage, dass es Willensfreiheit nicht gibt, a priori richtig, denn sie arbeiten dann mit einem Gegenstandsentwurf, in welchem die Willensfreiheit, gleich welcher Variante, als gegenständliche Größe nicht unterzubringen ist. Die Zugehörigkeitsprobe belegt dies. Es macht nämlich keinen Sinn, beispielsweise nach der elektrischen Ladung der Willensfreiheit zu fragen. Was man gegenständlich nicht zulässt, das kann man gegenständlich nicht finden. [159]
Wenn ROTH (2004a) mithin sagt: "Es gelingt nicht, irgendeinen Kausalzusammenhang zwischen dem Gefühl, etwas frei zu wollen ... und einer bestimmten Handlung nachzuweisen" (S.133), dann hat er analytisch zwingend Recht, sofern er mit einem "Kausalzusammenhang" einen Zusammenhang zwischen Größen meint, die im physischen Gegenstandsentwurf unterzubringen sind. Ein Gefühl, und sei es ROTHs "Gefühl, etwas frei zu wollen", übersteht nicht die Zugehörigkeitsprobe. Man kann an dieser Stelle nur SCHRÖDINGER (1989) beipflichten, der sagt, dass ein Blick unter die Schädeldecke höchst Interessantes offenbaren mag, doch Gefühle oder aber erlebend-gelebte Willensfreiheit als gegenständliche Erlebensgrößen, die sich bedingungskausal erforschen lassen, wird man nicht finden. Im naturwissenschaftlichen Kosmos gibt es sie demnach nicht. [160]
|
Ergänzung Damit niemand leichthin den Schluss zieht: "Na also, dann wissen wir doch, was wir wissen wollen. Es gibt keine Willensfreiheit", sei hier Folgendes wiederholt: Ein Blick unter die Schädeldecke offenbart auch kein Haben von Wissen, kein Denken, kein Verarbeiten von Informationen, kein Gedächtnis und so weiter. Dort gibt es all das nicht. Und im Gegenstandsentwurf der physischen Denkform gibt es auch keine neurowissenschaftlichen Theorien, keine aufschlussreichen experimentellen Befunde, keine impactträchtigen Artikel und so weiter als gegenständliche Größen. All dies gibt es in dem gleichen Sinne nicht, in dem es die Willensfreiheit nicht gibt. Dies sollten eingefleischt-monistische Naturwissenschaftler mit ontischen Totalisierungsneigungen bedenken. Wer aus Gründen der Totalisierung ontischer Setzungen der Willensfreiheit den Garaus macht, der macht folgerichtig auch seinem Forschen als gegenständlicher Gegebenheit den Garaus. [161] |
Jan SMEDSLUND (1988) hat den Begriff der pseudoempirischen Forschung geprägt. Damit meint er Untersuchungen, die behaupten, etwas empirisch zu belegen (z.B. durch das Ausmessen und Summieren der Innenwinkel ganz vieler Dreiecke), was analytisch oder a priori richtig ist (nämlich, dass die Innenwinkelsumme 180 Winkelgrade beträgt). In übertragenem Sinne ließe sich hier sagen: Wenn ROTH und andere sagen, Willensfreiheit gebe es nicht, und wenn sie dies im Rahmen der physischen Denkform denkend sagen, dann argumentieren sie pseudoempirisch, sofern sie meinen, diese Erkenntnis ergäbe sich aus einer Vielzahl von Laborexperimenten "über 'willentliche' Handlungssteuerung" (ROTH, 2004a, S.133). [162]
Halten wir fest: Innerhalb der physisch-naturwissenschaftlichen Denkform lassen sich über die Willensfreiheit keinerlei gegenständliche Existenz-, Beschaffenheits- oder Kausalaussagen machen, weil die Willensfreiheit in dem Kosmos der physisch-naturwissenschaftlichen Denkform erkenntnisgegenständlich nicht (auch nicht hypothetisch) unterzubringen ist. [163]
5.1.2 Willenfreiheit als Merkmal physischer Größen
Als eigenständige Größe übersteht die Willensfreiheit die Zugehörigkeitsprobe nicht. Aber muss man sie denn als eigenständige Größe fassen? Gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit, sie im physischen Kosmos gegenständlich zu verankern? Es sei daran erinnert, dass SEARLE (2000) davon spricht, dass geistige Zustände und Vorgänge "features of the brain" (S.4) seien. Lässt sich die Willensfreiheit, das "Gefühl, etwas frei zu wollen", nicht als ein Merkmal einer physischen Konstellation begreifen? Gelänge dies, so hätte man die Willensfreiheit im physischen Kosmos verankert, und so könnte man sie physisch bedingungskausal befragen. [164]
Dieser Hoffnungsschimmer verdunkelt sich aber sogleich wieder, wenn man die "Ohne anders?"-Probe vollzieht. Aus ihr ergibt sich nämlich, dass das vermeintliche "Willensfreiheits"-Merkmal, so man es einer physischen Konstellation anfügen will, ein kausal irrelevantes ist und als solches kann es beliebig hinzu- oder weggedacht werden und damit ist es weder gegenständlich angemessen verankert noch kausal erklärbar. [165]
5.1.3 Willensfreiheit als eine Größe in der Rubrik der Erkenntnismittel
Die Willensfreiheit erkenntnisgegenständlich unterzubringen gelingt nicht. Weniger Schwierigkeiten bereitet die Erkenntnisrubrik der Erkenntnismittel. Hier lässt sich die Willensfreiheit problemlos unterbringen, wenn man sagt, sie sei als Erfahrens- und Erlebensvollzug irgendwelchen neuronalen Größen konkomitant. BOUCSEIN (1999) spricht beispielsweise von Gefühlen als psychischen Konkomitanten physisch-neuronaler Zustände und Vorgänge, und ZHU (2004) meint, "acts of will" (S.303) bereits neuronal lokalisiert zu haben. Vergleichbar können Schmerzempfindungen psychische Konkomitanten bestimmter somatischer Zustände und Vorgänge sein. Sie sind dann zwar nicht selbst gegenständliche Bestandteile oder Merkmale physischer Zustände und Vorgänge, wohl aber sind sie diesen als psychische konkomitant. [166]
Solche konkomitanten Größen lassen sich als Indikatoren benutzen, als Größen also, die im Erkenntnisprogramm der physischen Denkform als Erkenntnismittel fungieren können. Ihre erkenntnisprogrammatische Stellung entspricht dann jener, die beispielsweise Bilder, die so genannte bildgebende Verfahren liefern, einnehmen. Die Bilder (z.B. PET-Bilder) sind wichtige, ja unerlässliche Indikatoren für erkenntnisgegenständliche physische Größen (z.B. Intensität des Glukoseumsatzes in einer Gehirnregion), doch gehören die Bilder als indizierende Daten nicht zum Erkenntnisgegenstand. Der ist das Gehirn und sein physisches Funktionieren. Die Bilder sind notwendige Erkenntnismittel. Sie liefern, um nochmals mit PLANCK (1943) zu sprechen, "Botschaften" (S.174) von einer "realen Welt" (ebd.), und "Botschaften" sind eben solche und keine physischen Größen. [167]
Sowohl die Willensfreiheit, wie auch die Schmerzen, wie auch die Daten bildgebender Verfahren, sie alle brauchen als "Botschaften" die Zugehörigkeitsprobe nicht zu überstehen. Sie dienen als Erkenntnismittel. Als Erkenntnisgegenstände jedoch haben sie im Erkenntnisprogramm der physischen Denkform keinen Ort. Da nun aber ROTHs Existenzfrage ("Gibt es Willensfreiheit?") auf erkenntnisgegenständliche Größen zielt, muss wiederum gesagt werden, dass das Erkenntnisprogramm der physisch-naturwissenschaftlichen Denkform so geartet ist, dass sich in ihm die Existenzfrage gegenständlich nicht verorten und somit nicht beantworten lässt. [168]
5.1.4 Willensfreiheit als strikt paralleles phänomenales Geschehen
Die Konkomitanzbeziehung zwischen physischen und psychischen Größen lässt sich aber nicht nur (innerhalb einer Denkform) indikatorisch nutzen, sondern man kann diese Beziehung auch als eine transversale Beziehung zwischen den Gegenstandsentwürfen zweier Denkformen auffassen. Dann muss man zuvor freilich zugestehen, dass es neben der physischen Realität auch eine phänomenale Realität gibt. Gesetzt den Fall, man macht dieses Zugeständnis (was eingefleischten Physikalisten natürlich äußerst schwer fällt, weswegen manche sogar den Epiphänomenalismus als eine Denkmöglichkeit ablehnen), dann ließen sich beispielsweise phänomenale und physische Geschehensverläufe parallelisieren. Es wird dann nicht eine der beiden Seiten zum Erkenntnismittel im Rahmen der gegenständlichen Erforschung der anderen gemacht, sondern beide werden als eigenständige Realitäten akzeptiert und entlang einer Zeitachse aufeinander bezogen. In diesem Sinne spricht ROTH davon, dass jedem (phänomenalen) Bewusstseinsgeschehen ein neuronales strikt parallel laufe (vgl. z.B. 1997, S.291). In einer schlichten Abbildung ließe sich das so darstellen:
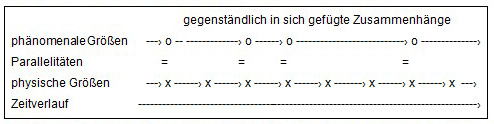
Gegen die Annahme und die Untersuchung solcher gegenständlicher Parallelitäten spricht natürlich gar nichts. Wer wagte es heute, daran zweifeln, dass jedem phänomenalen Geschehen ein physisches parallel
läuft? Aus solchen Parallelitäten mag man dann ermöglichungstheoretische Fragen ableiten, die beispielsweise rehabilitationspsychologisch
aufschlussreich sind. Doch manche Neurowissenschaftler begnügen sich mit dieser Nutzung empirischer Parallelitäten nicht.
Ein Beispielfall ist ROTH. Er nutzt sie als argumentativen Ausgangspunkt für explanative Ableitungen. Ich versuche, diese mal in eine Abfolge zu bringen:
Der erste Schritt ist ein unproblematisch nominaler. Aus strikten Parallelitäten zwischen physischen und phänomenalen Größen werden Korrelationen. Einer Abfolge phänomenaler Größen korreliert eine Abfolge physischer Größen.
Nun lässt sich der Begriff des "korrelativen Erklärens" (ROTH, 2001) einführen. Wenn zwei gegenständliche Größen X und Y immer zusammen auftreten, so kann man das Auftauchen der Größe Y korrelativ erklären durch den Nachweis, dass auch die Größe X aufgetaucht ist. Beispiel: Y mag das "Gefühl, etwas frei zu wollen" sein und X mag ein neuronales Ereignis sein.
Dem korrelative Zusammenhang zwischen X und Y wird nun eine einseitige Richtung verliehen. X kann zwar Y korrelativ erklären, doch Y kann nicht X korrelativ erklären. Beispiel: Das neuronale Ereignis X kann zwar das "Gefühl, etwas frei zu wollen" Y korrelativ erklären, aber nicht umgekehrt. Ich nenne das im Folgenden "unilateral-korrelatives Erklären". [169]
Auf der Grundlage dieser Behauptungen wird nun gesagt, phänomenale Gegebenheiten und Zusammenhänge ließen sich durch physische Gegebenheiten und Zusammenhänge korrelativ erklären, wobei dann häufig das Wort "korrelativ" weggelassen wird. Eine Frage wie "Ist Geist naturwissenschaftlich erklärbar?" (Thema eines Vortrags von ROTH, 2001) wird dann klar bejaht (wobei "Geist" in der Regel mit phänomenalen Bewusstseinsgegebenheiten gleichgesetzt wird). [170]
Es geht mir im Folgenden nicht darum, das unilateral-korrelative Erklärungsschema auf seine innere Stimmigkeit und Haltbarkeit hin zu durchdenken (vgl. hierzu LAUCKEN, 2003b). Ich akzeptiere es zum Zwecke des Argumentierens schlicht einmal. Und dennoch, so behaupte ich, hat ROTH (2001) Unrecht, wenn er sagt, auf diese Weise könne er Bewusstseinsgegebenheiten neurowissenschaftlich erklären. Nehmen wir uns mal beispielhaft das "Gefühl, etwas frei zu wollen" (ROTH, 2004a) vor! Warum ROTH auch innerhalb seines eigenwilligen unilateral-korrelativen Erklärungsschemas Unrecht hat, das möchte ich zunächst bildlich demonstrieren:
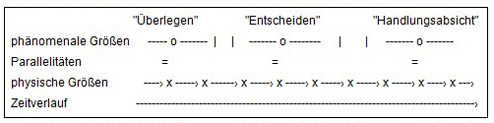
Nun greife ich auf die Explikationen zum Begriff der Willensfreiheit zurück. Ich erinnere an ein konstitutives Bestimmungsmoment,
das allen drei Varianten der Willensfreiheit gemeinsam ist. Es geht um deren notwendige inferenzielle Einbettung. Das "Gefühl, etwas frei zu wollen" kann als solches phänomenal nur existieren, wenn es inferenziell eingebettet ist. Niemand
wird das "Gefühl, etwas frei zu wollen" erleben, wenn dieses gleichsam eruptionsartig aus ihm hervorbricht. Phänomenal forschende
Wissenschaftler sprächen von der notwendigen narrativen Einbettung, die jede phänomenale Größe erfahren muss, um als sinnvolle
erfahren und gelebt werden zu können. Hat sich in diesem Sinne jemand verschiedene Handlungsmöglichkeiten "überlegt", hat
er sich für eine "entschieden" und fasst er daraufhin eine entsprechende "Handlungsabsicht" ... und so weiter, dann mag dieser
Jemand in einem solchen Sinnzusammenhang das "Gefühl, etwas frei zu wollen" erleben und den Vollzug einer freiwilligen Tat
erfahren können. [171]
Durch das unilateral-korrelative Erklärungsschema modo ROTH wird die für die Willensfreiheit konstitutive inferenzielle Einbettung nun aber zerstört. An die Stelle eines Sinnzusammenhangs tritt als explanatives Geschehen ein rein raumzeitlich koordinierter neuronaler Ablauf, dem jede inhaltliche Inferenzstruktur fehlt (und zwar per definitionem). Bildhaft gesprochen: Die phänomenalen Größen baumeln gleich Luftballons an bestimmten physischen Größen. Diese stiften den explanativen Zusammenhang, die phänomenalen Luftballons untereinander sind gegenständlich zusammenhanglos. Jemand fasst dann nicht eine Handlungsabsicht, weil er sich etwas überlegt hat und weil er daraufhin bestimmte Entscheidungen getroffen hat, vielmehr fasst jemand eine Handlungsabsicht, weil ein korrelativ paralleles neuronales Ereignis X stattgefunden hat. Und dieses hat stattgefunden, weil raumzeitlich zuvor ein neuronales Ereignis Y stattgefunden hat, welches wiederum durch ein vorauslaufendes neuronales Ereignis Z verursacht worden sein mag, dem vielleicht die phänomenale Größe "Entscheiden" strikt parallel sein mag ... und so weiter. [172]
Wer so vorgeht, löst einen erlebend-gelebten Sinnzusammenhang, in dem das "Gefühl, etwas frei zu wollen" ein Sinnmoment sein mag, auf und ersetzt diesen durch einen sinnentleerten raumzeitlich koordinierten physischen Zusammenhang. Durch diese Ersetzung ist aber das zunichte gemacht, was die Willensfreiheit gegenständlich auszeichnet. Wenn man so verfährt, dann hat man die Frage, ob es denn die Willensfreiheit gibt, wiederum durch die Art, sich dieser Frage zu nähern, bereits a priori beantwortet. Gegenständliche Forschung, die der Frage nachgeht, ob es so etwas gibt, kann man sich ersparen, wenn man dieses Etwas vorab durch die Art des Forschungszugriffs bereits zunichte gemacht hat. [173]
5.1.5 Die falsifikatorische Irrelevanz LIBETscher Untersuchungen
Zum Zwecke des Argumentierens lasse ich mich weiterhin auf das (meines Erachtens fehlerhafte; vgl. LAUCKEN, 2003a/b) unilateral-korrelationistische Erklärungsschema ein. [174]
Bei der Interpretation der LIBETschen Untersuchungen durch ROTH (vgl. z.B. 1997; 2004a) fällt auf, dass er LIBETs Schlussfolgerung, dass dem Menschen zwar die Spontaneitätswillensfreiheit nicht gegeben sei, wohl aber die Unterbindungswillensfreiheit, nicht übernimmt, ja, ROTH unterschlägt diesen Teil der LIBETschen Gedankenführung. Und ich glaube, er tut dies zu Recht, allerdings aus Gründen, die wohl nicht die seinen sind. Die Überlegung freilich, dass durch "LIBET's gap" die Spontaneitätswillensfreiheit experimentell falsifiziert sei, teilt ROTH mit LIBET. Und ich glaube, er tut dies zu Unrecht. Was hat LIBET herausgefunden?
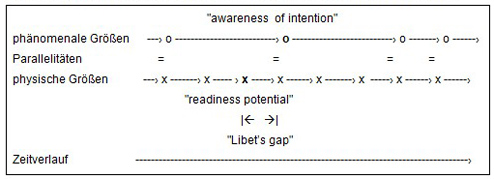
Die Zeitlücke zwischen Bereitschaftspotenzial und Intentionsgewahrwerden ist für LIBET, ROTH, SINGER und andere eine experimentelle
Falsifikation der Existenz von Willensfreiheit, hier: der Spontaneitätswillensfreiheit. Der Befund gilt als empirischer Beleg
dafür, dass es die Willensfreiheit als Realität nicht gibt. Falsifikationen gelten nur dann als solche, wenn ein anderer Befund
keine Falsifikation darstellte. Man stelle sich probehalber einmal einen anderen Befund vor:
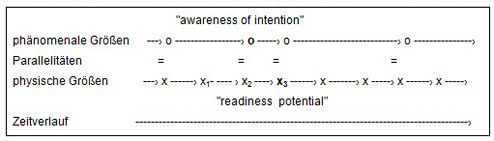
Wäre ein solcher Befund ein experimenteller Beleg dafür, dass es Spontaneitätswillensfreiheit gibt? Mitnichten! Denn natürlich
läuft dem unilateral-korrelativen Erklärungsschema gemäß auch der "awareness of intention" eine physische Größe x2 parallel, die die "awareness of intention" (korrelativ) erklärt. Und selbstverständlich ist diese Größe x2 ihrerseits physisch verursacht, durch die Größe x1. Damit wäre dann aber auch das Intentionsgewahrwerden physisch "determiniert" und damit, dem neurodeterministischen Argumentieren ROTHs folgend, außerhalb der Sphäre irgendwelcher (freier) Willenszugänglichkeit. Eine über strikte Parallelitäten vermittelte
physisch determinierte Spontaneität wäre, folgen wir ROTHs Denken, ein Unding und keine Verifikation solcher Spontaneität.
Folgerichtig sagt SINGER (2003) in einem Vortrag apodiktisch: "Jedem mentalen Prozess muss ein neuronaler vorausgehen" (m. Hervorh.). [175]
Was auch immer bei den Untersuchungen LIBETscher Prägung und ihrer ROTHschen Deutung herauskommt, sie sind untauglich, die Frage der Existenz oder Inexistenz der Willensfreiheit zu beantworten, weil von vornherein dadurch, wie die Willensfreiheit erkenntnisprogrammatisch und erklärungsschematisch eingebaut ist, klar ist, dass Willensfreiheit inexistent sein muss. [176]
Innerhalb der physischen Denkform ist Willensfreiheit erkenntnisgegenständlich nicht unterzubringen. Darüber hilft auch keine unilateral-korrelationistische Erklärungsakrobatik hinweg. Wenn Neurowissenschaftler wie ROTH (2004a), SINGER (2003), DAMASIO (1995), CRICK (1997) und andere behaupten, es gäbe die Willensfreiheit gegenständlich nicht, dann ist diese Aussage, sofern sie innerhalb der physischen Denkform geäußert worden ist, vollkommen richtig, allerdings nicht aus empirischen, sondern aus analytischen (oder tautologischen) Gründen. Eine "Aufklärung", die so zustande kommt, ist nicht sonderlich erhellend. [177]
Ich habe so ausführlich über die Eigenart der physisch-naturwissenschaftlichen Denkform, über den Kosmos, den sie entwirft, und darüber, was alles aus diesem a priori gegenständlich ausgeschlossen wird, geredet, weil damit deutlich wird, wie die neurowissenschaftlichen Versuche, so etwas wie Willensfreiheit zu fassen, einzuschätzen sind. Nicht die schiere Macht der Empirie, wie die kopernikanischen Himmelsbeobachtungen, zwingt die Menschen, von der Idee der Willensfreiheit abzulassen und sie als Illusion zu erkennen. Es sind vielmehr begriffliche Baueigenarten der physisch-naturwissenschaftlichen Denkform, die es unmöglich machen, der Willensfreiheit einen gegenständlichen Ort zuzuweisen, der sie gegenständlich erforschbar macht, und sei es nur im Blick auf die Existenz-Hypothese. Daraus die Überzeugung abzuleiten, man habe wissenschaftlich bewiesen, dass es die Willensfreiheit nicht gibt, heißt, den eigenen Setzungen auf den Leim gegangen zu sein. Zur Frage der Existenz oder Inexistenz der Willensfreiheit hat die physisch-naturwissenschaftliche Denkform ebenso nichts zu sagen, wie sie nichts darüber zu sagen hat, ob es z.B. mathematische Kalküle, physikalische Theorien oder wissenschaftliche Artikel als reale Gegebenheiten gibt. Ich wage zu vermuten, dass selbst Neurowissenschaftler aus dieser Einsicht nicht ableiten, dass all dies dann offenkundig illusionäre Gebilde sind, bar jeden Realitätsgehalts. Sonst müssten sie sich fragen lassen, was es denn ist, wofür sie beispielsweise wissenschaftliche Impact-Punkte sammeln, um sich bei Stellenbewerbungen vorzustellen. Ich mutmaße, sie verstehen sich nicht als Illusionisten, die den Berufungskommissionen etwas Irreales vorgaukeln. [178]
Ich will meine Überlegungen aber nicht damit abschließen, dass ich darlege, in welcher Denkform die Frage nach der gegenständlichen Existenz der Willensfreiheit nicht erforscht werden kann, sondern ich möchte diesbezüglich auch noch die semantische und die phänomenale Denkform befragen. [179]
5.2 Willensfreiheit und die semantische Denkform
Wenn man sich den Gegenstandsentwurf der semantischen Denkform vergegenwärtigt und in diesem die pragmasemantische Analyseebene, dann tauchen Handlungen als verweisungsstrukturell maßgebende Größen auf. Wenn man sich weiterhin vergegenwärtigt, dass die Willensfreiheit eine Größe ist, die nur handlungsbezüglich sinnvoll zu bestimmen ist, dann rücken als Medium der Vergegenständlichung von Willensfreiheit semantische Prozesse, die dem Handeln verweisungskausal antezedent sind, ins Blickfeld. Ich erinnere nochmals an den Satz: "When thought seems to cause action, we experience will" (WEGNER & ERSKINE, 2003, S.685). Welche geistigen/kognitiven/informationsverarbeitenden/gedanklichen und dergleichen Vollzüge sind es, die den verschiedenen Varianten der Willensfreiheit zukommen? Hat man die Antwort-Arbeit, bei der man sich an den oben (s. Abschn. 3.) dargestellten Explikationsergebnissen ausrichten kann, geleistet, so könnte man sich anschicken, gleichsam als handliches Erkenntnisergebnis, die Baupläne jener kognitiven Informationsverarbeitungsprogramme zu entwerfen, welche den unterschiedlichen Willensfreiheitsvarianten zugrunde liegen. Bei der Besinnungswillensfreiheit käme man dabei vielleicht auf die Idee eine selbstreferenzielle Verarbeitungsebene einzubauen, vergleichbar der intellektuellen Handlungsregulation bei HACKER (1978) oder den Metakognitionen bei NELSON (1996) ... und so ließe sich weiter daran basteln, Willensfreiheit als semantische Prozesskonfiguration einer bestimmten Verweisungsarchitektur zu vergegenständlichen. So könnte man zu der Ansicht gelangen, dass die Willensfreiheit, gleich welcher Variante, in der semantischen Denkform und ihrem Kosmos angemessen zu vergegenständlichen sei, es bedürfte nur geeigneter "Programmierungsarbeit", um ihren "Bauplan" (DÖRNER, 1999) zu erfassen. Leider muss ich dieser Vermutung widersprechen. [180]
|
Ergänzung Dieser Vermutung muss ich nicht aus Gründen widersprechen, wie sie HERRMANN (1987) erörtert. Bei seinen Überlegungen steht wohl noch die Ansicht Pate, dass die Willensfreiheit das Vorhandensein gleichsam eines kausalen Nullpunkts voraussetzt. Ein solcher, falls es ihn gäbe, würde aber die Vorhersagbarkeit menschlichen Handelns, sofern dieses willensfrei vollzogen wird, unmöglich machen. Wissenschaftler suchen aber nach Vorhersagbarkeiten, und seien sie noch so umgrenzt. Die Annahme der Willensfreiheit käme somit einer wissenschaftlichen Kapitulation gleich. Dazu ist Folgendes zu sagen: Die Explikation dessen, was im alltagspraktischen Lebensvollzug als Willensfreiheit gelebt wird, ergibt eine Willensfreiheit, die, falls es sie so gibt, keineswegs eine Kapitulation vor Vorhersagewünschen nach sich zieht. Wenn man bei einem Menschen vorhersagt, er werde sich bei einem bestimmten Satz von Handlungsalternativen nach dem Abwägen dieser und jener faktischen und valuativen Prämissen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit für eine Handlungsalternative entscheiden und ihr gemäß handeln, dann spricht man diesem Menschen doch damit nicht das ab, was man lebenspraktisch unter Willensfreiheit versteht. Vor allem spricht man es ihm dann nicht ab, wenn man ihm unterstellt, er habe nicht habituell-eingeschliffen entschieden und gehandelt, sondern besonnen. Willensfreiheit und Vorhersagbarkeit schließen sich nicht aus, vielmehr sagt man oft ein bestimmtes Handeln vorher, vorausgesetzt ein Mensch könne sich willensfrei entscheiden. Falls jemand unbedingt darauf aus ist, irgendetwas "Nullpunkt"-Analoges finden zu wollen, so könnte dies etwa bei der Besinnungswillensfreiheit der Beschluss sein, sich ausreichend besonnen zu haben – ausreichend, um vom vorbereitenden Nachdenken zum eingreifenden Handeln schreiten zu können. In KAMINSKIs (1970) Handlungstheorie wäre dies die Entscheidung des Handelnden, von der diagnostischen zur praktischen Phase des Handelns überzugehen. Aber wie dem auch sei, ich möchte hier eine andere Schwierigkeit der semantischen Vergegenständlichung von Willensfreiheit ansprechen. [181] |
Bei der Explikation der gemeinsamen Merkmale der verschiedenen Varianten der Willensfreiheit wurden drei Merkmale hervorgehoben: Ich-Bezug, intentionale Anbindung und inferenzielle Einbettung. Die beiden letzten Merkmale lassen sich problemlos "programmieren" (d.h. programmanalog darstellen). Anders sieht es mit dem Ich-Bezug aus. In den üblichen kognitiven Informationsverarbeitungstheorien (vgl. z.B. LINDSAY & NORMAN, 1973) oder in den gebräuchlichen psychologischen Handlungstheorien (vgl. z.B. GREVE, 1994) taucht dieser nicht auf. Und es ist auch gar nicht einfach, ihn irgendwie einzubauen. Eine schlichte Idee, dass man aus Differenzen wie "Zaun ist hoch/Zaun ist niedrig" und "drum herum gehen/darüber springen" Differenzen macht wie "ich schätze den Zaun als hoch ein/ich schätze den Zaun als niedrig ein" und "ich gehe drum herum/ich springe darüber", erweist sich bei näherem Hinsehen als zu schlicht. Würde man so verfahren, so zerstörte man den Ich-Bezug in seiner Eigenart als durchgängige und überdauernd existente Bezugsmitte. Der Ich-Bezug wäre in unterschiedlichste Differenzen zerstückelt. Es fehlte die semantische Vergegenständlichung der personalen Instanz, die sich als Handlungseinheit erfährt, die ihr Handeln leibhaftig vollzieht, die sich ihr Handeln zurechnet, die sich schämt, die auf sich stolz ist ... die von sich sagen kann: Das mache ich freiwillig! [182]
|
Ergänzung Zu dieser Ergänzung animiert mich nochmals das Interview mit dem Neurophilosophen METZINGER (in Süddeutsche Zeitung, 5. 8. 2003): In diesem Interview sagt METZINGER (ich wiederhole das Zitat): "Zweck dieses Modells (des Selbstmodells, das als "Ich" fungiert; U.L.) ist es, sich in der äußeren Welt zu orientieren, mit anderen bewussten Wesen zu kommunizieren und Aufmerksamkeit und Denken auf sich als Ganzes lenken zu können. ... (Das Modell) ist ... eine geschickte Art, den Informationsfluss zu organisieren". Wenn das alles so ist, dann erstaunt es umso mehr, dass in üblichen (kognitiv-) semantischen Informationsverarbeitungstheorien (aber auch in den KI-Theorien) eine Ich-Instanz, die zu "lenken" und zu "organisieren" in der Lage ist, fehlt. Da gibt es zwar selbstrerenzielle oder metakognitive Prozesseinheiten (so schon beim General Problem Solver von NEWELL, SHAW & SIMON, 1958), aber das sind keine ichzentrierten "Selbstmodelle", die als solche eingreifend fungieren können. – Es bleibt dabei: Der Ich-Bezug findet in semantischen Vergegenständlichungen meist keinen Ort, obgleich er laut METZINGER notwendig wäre. [183] |
Es liegt mir an dieser Stelle fern, zu behaupten, die Schwierigkeiten, die ich hier sehe, ließen sich nicht innerhalb der semantischen Denkform bewältigen. Man könnte sich ja auch eine Theorie vorstellen, die den menschlichen Lebensvollzug als eine verweisungskausale Abfolge ich-zentrierter Konstellationen kopräsenter semantischer Einheiten vorstellt (vgl. LAUCKEN, 2003, S.174f.). Beispielhaft ließe sich an LEWINs (1935) Begriff des Lebensraums denken. Der Lebensvollzug ließe sich dann als verweisungskausal schlüssige Abfolge von Lebensraumkonstellationen vergegenständlichen. [184]
Doch gerade, wenn man den Begriff des Lebensraumes nimmt, stößt man zu einer weiteren, jetzt grundsätzlichen Frage vor, die bei dem Versuch der semantischen Vergegenständlichung der Willensfreiheit auftaucht. [185]
Der Lebensraum ist zwar eine personal zentrierte semantische Konstellation, er ist jedoch keine Konstellation, die das jeweils phänomenale In-der-Welt-Sein eines Menschen ausmacht. LEWIN legt Wert darauf, den Lebensraum nicht etwa als phänomenales Feld (z.B. als "Bewusstseinsfeld", GURWITSCH, 1975) misszuverstehen (vgl. dazu BALDWIN, 1967). Zu diesem steht er vielmehr in einem "konditional-genetischen" Verhältnis. Damit taucht die grundsätzliche Frage auf, ob die Willensfreiheit nur dann eine solche ist, wenn sie als solche erlebend-gelebt wird. Wäre dies der Fall, dann ließe sie sich lediglich in der Denkform vergegenständlichen, deren Gegenstandsentwurf das phänomenale Gegebensein zum Grundmerkmal seines Seins erhebt – in der phänomenalen Denkform. [186]
5.3 Willensfreiheit und die phänomenale Denkform
|
Ergänzung Das phänomenale Sein ist jenes Sein, von dem die Phänomenologen sagen, es sei das einzige, das den Menschen als unmittelbar zugängliches gegeben ist. Auch Dinge werden erst in ihm zu solchen: "We evidence thing. We let them appear" (SOKOLOWSKI, 2000, S.161). Seine eigenständige Existenz zu bestreiten, liefe darauf hinaus, das zu bestreiten, was man als Bestreitender gerade lebt. ... Aber ich will mich hier nicht in fundamentalontologischen Überlegungen ergehen. Ich will nur noch einmal den Sinn dafür schärfen, dass man sich mit der phänomenalen Denkform nicht in irgendwelchen gegenständlich dünnluftigen Höhen bewegt, sondern dass man auch in dieser Denkform gegenständlich ganz und gar bodenständig ist. Dies immer wieder zu betonen, ist gerade gegenüber Psychologen wichtig, die phänomenaler Forschung gegenüber traditionell (seit der Überwindung der so genannten Bewusstseinspsychologie und deren eigenwilliger Methodik) äußerst skeptisch sind, und zwar aus Gründen, die mit der Grundlegung phänomenaler Forschung meist gar nichts zu tun haben (vgl. LAUCKEN, 2003a, S.303ff.). Das heißt, sie lehnen ein Bild, das sie sich von der phänomenalen Forschung machen, ab, welches der phänomenalen Denkform gar nicht entspricht. [187] |
Der Kosmos der phänomenalen Denkform ist bestens geeignet, die Willensfreiheit mit all ihren Varianten gegenständlich aufzunehmen, und zwar aus zwei Gründen:
Erster Grund: Die Willensfreiheit ist eine phänomenale Gegebenheit. HAGGARD und LIBET (2001) sprechen von "conscious free will" und von "awareness of intention". Ihr phänomenales Gegebensein ist demnach für sie konstitutiv. Mit Bewusstsein ist offensichtlich das phänomenale (awareness) Bewusstsein gemeint (und nicht z.B. irgendeine metakognitive Informationsverarbeitungseinheit; vgl. dazu LAUCKEN, 2003a, S.289ff.). In den Gegenstandsentwürfen der physischen und der semantischen Denkform ist Phänomenalität als gegenständliche Qualität nicht unterzubringen. Versuche, diese Qualität irgendwie dazuzupacken, scheitern an der "Ohne anders?"-Probe. Es liegt mithin auf der Hand, dass die Willensfreiheit, so wie sie von Neurowissenschaftlern wie LIBET bestimmt wird, sich gegenständlich allein in der phänomenalen Denkform versuchsweise unterbringen lässt – gleichgültig also, ob man sie irgendwann im Nachhinein als Illusion zu entlarven hofft. [188]
Zweiter Grund: Der phänomenale Kosmos ist bestens geeignet den konstitutiven Ich-Bezug der Willensfreiheit gegenständlich aufzunehmen. Wie dargelegt, hat die semantische Denkform gewisse Schwierigkeiten, dieses Bestimmungsmoment in sich gegenständlich plausibel zu realisieren. Was bei der semantischen Denkform schwierig ist, ist bei der phänomenalen Denkform nicht nur problemlos, sondern es ist ihr urtümlich eigen. Der phänomenale Kosmos erlebend-gelebten In-der-Welt-Seins ist stets ich-bezüglich artikuliert und strukturiert. Selbst in den seltenen Augenblicken der Ich-Vergessenheit (z.B. beim so genannten Flow-Erleben) zeigt sich dieser Ich-Bezug gleichsam dialektisch. [189]
Man bemerkt den für den phänomenalen Kosmos konstitutiven Ich-Bezug sogleich, wenn man sich wichtige gegenstandserfassende Begriffe der phänomenalen Forschung vergegenwärtigt. Die phänomenale Welt ist intentional strukturiert, sie ist perspektivisch gegliedert, sie ist horizonthaft erstreckt und so weiter. All diese gegenständlichen Erfassungsmomente werden haltlos ohne einen personalen Bezugspunkt. Deutlich tritt dieser in der bereits zitierten Bestimmung der phänomenalen Welt durch LÜBBE (1972) hervor: "... die subjektive Totalität jener praktisch-sinnerfüllten Wirksphäre, der der Mensch niemals in monadischer Isolierung gegenübersteht, die er vielmehr in seinem konkreten Dasein ist" (S.76). Und in der "narrativen Phänomenologie" (WÄLDE, 1985, S.91) Wilhelm SCHAPPs (1959, 1976) leben Menschen stets ein ich-bezüglich zentriertes, geschichtenförmiges Leben. Menschen existieren stets und nur als ich-bezüglich irgendwie in Geschichten verstrickte Wesen. [190]
|
Ergänzung Zur Klärung des bei der Rede vom Ich-Bezug gebrauchten Ich-Begriffs ist eine Unterscheidung WITTGENSTEINs (1958, S.66f.), die ich schon einmal oben verwendet habe, hilfreich. Er unterscheidet zwischen einem Ich als Subjekt und einem Ich als Objekt. Das Ich als Subjekt ist das Lebensvollzugs-Ich (z.B. ich will das, ich sehe dies, ich empfinde jenes, ich tue das). Das Ich als Objekt ist ein Gegenstands-Ich, welches sich das Lebensvollzugs-Ich in Akten der Besinnung beispielsweise vorstellt (z.B. "Ich denke über mich nach"). G.H. MEAD (1934) trennt vergleichbar zwischen "I" (Lebensvollzugs-Ich) und "Me" (Gegenstands-Ich). Strukturierungszentral für den phänomenalen Kosmos ist das Lebensvollzugs-Ich (wobei man die Frage aufwerfen kann, ob sich nicht beide Ichs bestimmungswechselseitig bedürfen; vgl. PROUST, 2003). [191] |
Wie lässt sich in diesem phänomenalen und ich-bezüglich geordneten Kosmos Willensfreiheit dingfest machen? Auch die Willensfreiheit, auch das "Gefühl, etwas frei zu wollen" (ROTH, 2004a) wäre ganz im Sinne der narrativen Phänomenologie ein Moment einer erlebend-gelebten Geschichte und nur als ein solches mit Daseinssinn ausgestattet. Ich erinnere an die Feststellung: "Auch Gefühlsregungen ... tauchen nur in Geschichten auf, in Geschichten, in die wir verstrickt sind" (SCHAPP, 1976, S.148). So ließe sich sagen, dass die Willensfreiheit nur als ein Sinnmoment einer Geschichte, die ein Mensch erlebend lebt, vorkommen kann. [192]
Will man Willensfreiheit als Moment narrativer Strukturen bestimmen, so muss man eben diese Strukturen, die der Willensfreiheit durch Einbettung ihren Sinn geben, durch phänomenal-sinnanalytische Forschung erkunden. Als Erkenntnisziel mag man danach streben, den narrativen Plot zu finden, der als Leerstellengefüge dazu taugt, konkret unterschiedliche Episoden, in denen Willensfreiheit mustergültig erlebend gelebt wurde, subsumierend zu erfassen. Dabei wird sich zeigen, dass die Willensfreiheit-Plots der oben unterschiedenen Willensfreiheitsvarianten sich markant unterscheiden. Wie diese im Einzelnen aussehen, bedarf phänomenanalytisch-empirischer Forschungsarbeit. Die oben (vgl. Abschn. 3) geleistete Explikationsarbeit mag dafür Hypothesen generieren. [193]
Wenn ich hier einmal spekulieren darf: Der erlebend-gelebten Spontaneitätswillensfreiheit, wie sie LIBET in seinen Experimenten zu inszenieren versucht hat, liegt, so vermute ich, ein Plot zugrunde, den wohl die meisten Menschen in ihrem Lebensvollzug auf den ersten Blick gar nicht als Willensfreiheit-Plot erleben würden. Man müsste den Menschen wohl eingehend erläutern, warum das spontane Krümmen eines Fingers gemäß der Instruktion eines Versuchsleiters, dies spontan zu tun, eine experimentelle Realisation ihrer Willensfreiheit ist. Aber, wie Gerhard ROTH in seinen diversen öffentlichen Diskussionen gezeigt hat, kann man diese Überzeugungsarbeit wohl schaffen. Schließlich sahen selbst Philosophen wie SLOTERDIJK und SAFRANSKI diese experimentelle Inszenierung als eine aussagekräftige Inszenierung von Willensfreiheit an. [194]
Weniger müsste man sich wohl bemühen, so vermute ich, ginge es um die erlebend-gelebte Besinnungswillensfreiheit. Sie ist es wohl, von der Jean Paul SARTRE (1943) sagt, es sei unsinnig zu fragen, ob es sie gebe. Als Menschen sind wir zu dieser Willensfreiheit geradezu verdammt: Die Menschen sind "condamnés à la liberté, jetés dans la liberté" (S.565). Warum er davon spricht, dass wir (zumindest gelegentlich) zu ihr verdammt seien, wird demjenigen verständlich, der sich an lebensweltliche Realisierungen der Willensfreiheit erinnert, die ihm schlaflose Nächte bereitet haben. Ein Sich-nicht-entscheiden-Können kann einen an den Rand der Verzweiflung treiben (vgl. TELLENBACH, 1961). Gerne würden wir uns dann unserer Freiheit entledigen, doch auch dies zu tun, wäre, so müssen wir erkennen, ein Akt der Freiheit. [195]
SARTRE schildert in seinen Dramen vielfältige Situationen, die das Leben von Besinnungswillensfreiheit beinhalten und die sehr quälend sind, bis hin zu Entscheidungen und Handlungen unter der Folter. Wie der Historiker Johannes FRIED (Süddeutsche Zeitung, 2004, Nr. 113, S.12) berichtet, entstand die moderne Vorstellung der Willensfreiheit in Auseinandersetzung mit der Folter. Im Griechenland der klassischen Epoche gab es für gerichtliche Aussagen von Sklaven die Folterprüfung. Dies war ein gesetzlich vorgeschriebenes Mittel zur Überprüfung des Wahrheitsgehalts von Aussagen. Auch im Mittelalter galt die Folter als akzeptables Mittel der Wahrheitsfindung, nun nicht mehr nur gegenüber Sklaven. Man ging davon aus, dass die Folter den Willen zur Lüge bricht und die Wahrheit erzwingt. Erst, so sagt FRIED, als in dem Templerprozess von 1308 die Erfahrung gemacht wurde, dass Menschen auch unter der Folter lügen können, entstand der Gedanke, dass es einen "freien Willen" gibt, den nichts bezwingen kann. [196]
Die phänomenale Denkform liefert uns also jenen Kosmos, in welchem die Willensfreiheit ihren gleichsam ureigenen gegenständlichen Ort hat. Und es ist wohl auch dieser Kosmos, den David HUME (vgl. 1955) meint, wenn er sagt, in ihm sei die Willensfreiheit eine Leitgröße menschlicher Lebensführung. Dieser Willensfreiheit illusionären Charakter zuzuweisen, weil sie in anderen Gegenstandsentwürfen nicht unterzubringen ist, ist ein Taschenspielertrick, weil a priori klar ist, das allein schon der Versuch, dies zu leisten, an der gegenständlichen Bauart der anderen Gegenstandsentwürfe scheitern muss. [197]
|
Ergänzung Manchen gleichsam fundamentalistischen Vertretern der physischen Denkform mag man noch das Zugeständnis abringen, dass es neben ihrem Realitätsentwurf noch andere geben könne, doch, so mögen sie das Zugeständnis gleich wieder einschränkend fortfahren, es sei doch wohl unstrittig, dass die physische Realität gleichsam die härteste und wohl auch die ursprünglichste sei. Vergleichbare Ursprungs-Behauptungen finden wir aber auch bei fundamentalistisch argumentierenden Phänomenologen, wenn es um den primordialen Status der phänomenalen Welt geht ("some kind of roundabout derivation of the physical from the phenomenal", BARKIN, 2003, S.4). Ich hoffe, mit meiner Erörterung der verschiedenen Denkformen, ihrer Eigenarten, ihrer Leistungen und ihrer Grenzen gezeigt zu haben, dass solche ontischen Prämierungen erkenntnisstrategisch unfruchtbar sind. [198] |
5.4 Willensfreiheit und ermöglichungstheoretische Überlegungen
Ermöglichungstheoretische Fragen rücken nur dann ins Blickfeld, wenn man nicht usurpatorisch denkt, sondern den Gegenstandsentwürfen der drei Denkformen gleichwertigen Realitätscharakter zuerkennt, um sie sodann mit irgendwelchen ermöglichungstheoretischen Hypothesen aufeinander zu beziehen. Hypothesen, die der Frage entspringen: "Wie ist es möglich, dass ...?" – Ich möchte zwei Beispiele geben. [199]
Erstes Beispiel: Gesetzt den Fall, man hätte den Plot des erlebend-gelebten Vollzugs der Besinnungswillensfreiheit in phänomenal-sinnanalytischer Forschung erkundet. Ermöglichungstheoretisch denkend mag man nun annehmen, dass dieses phänomenale Geschehen durch ein bestimmt geartetes semantisches Geschehen ontisch ermöglicht sein muss. [200]
Wie muss ein Mensch semantisch prozessieren, über welche Prozesseinheiten muss er verfügen, welche semantischen Größen muss er dabei verarbeiten und so weiter? Der phänomenale Ich-Bezug etwa, so mag man vermuten, setzt voraus, dass Menschen über die Differenz "Ich/Nicht-Ich" verfügen. Bei der Besinnungswillensfreiheit, so mag man weiterhin vermuten, muss das semantische Verarbeitungsprogramm eine selbstreferenzielle Schleife enthalten. Schließlich mag man vermuten, dass das phänomenale gleichzeitige Präsenthalten verschiedener Ploteinheiten durch das Vorhandensein bestimmter Gedächtnisleistungen ontisch ermöglicht wird ... und so ließe sich fortfahren. [201]
Die semantische Ermöglichungsebene mag man nun ihrerseits, so man schichtenontologisch theoretisiert, daraufhin befragen, welche physischen, hier wohl neuronalen Strukturen und Prozesse als ermöglichende erforderlich sind. So unterstellen etwa GEORGIEFF und JEANNEROD (1998), dass es ein neuroanatomisch lokalisierbares "'Who'-system" im Gehirn gibt. Dieses muss neuronal vorliegen, damit Menschen ihr Handeln sich selbst als eigenes Handeln zuschreiben können. Sind entsprechende neuronale Zentren lädiert, so können Menschen beispielsweise nicht sagen, ob sie ein Verhalten automatisch imitiert oder absichtlich ausgeführt haben. BÜRGY (2003) berichtet von einem an Schizophrenie erkrankten Menschen, der daran zweifelte, dass er es ist, der etwas tut: "Beim Händewaschen habe er seine Hände immer wieder auseinander und zusammenführen müssen, um zu spüren, dass es sich um seine Hände, seine Bewegungen handele" (S.10). Ermöglichungstheoretisch mag man weiterhin die unterstellten Gedächtnisleistungen befragen (vgl. z.B. FERNANDEZ & WEBER, 2003; MARKOWITSCH, 2001, 2002) und so weiter. [202]
Das sind alles hochinteressante und beispielsweise rehabilitationspsychologisch wichtige Fragen. Doch keine Antwort auf diese Fragen kann zu dem Schluss führen, dass es Willensfreiheit, welcher Variante auch immer, nicht gibt. [203]
Zweites Beispiel: Dieses Beispiel erwähne ich, weil es in manchen Diskussionen auftritt und weil es meines Erachtens auf einem Fehlverständnis (das ich bereits in einem Ergänzungskasten angesprochen haben) beruht. [204]
Entgegen der oben (vgl. Abschn. 3) vorgenommenen Explikation auch der Spontaneitätswillensfreiheit hält sich immer noch bei vielen die Auffassung, dass die Willensfreiheit die Existenz gleichsam eines kausalen Nullpunktes (also einer unbedingten Bedingung, die somit prinzipiell nicht vorhersagbar ist) voraussetzt. Wenn man dieser Idee nachhängt, dann kann man nach Strukturparallelitäten im semantischen und im physischen Kosmos suchen. Und da erblickt man dann einige Angebote, etwa die Quantenmechanik oder die Chaostheorie (vgl. z.B. PENROSE, 1991; POPPER & ECCLES, 1982; WALTER, 1998). [205]
Die Chaostheorie erfreut sich zurzeit besonderer Beliebtheit (man durchstöbere zur Probe das Internet mit den Stichworten Willensfreiheit und Chaos). Die Darlegungen beginnen häufig mit einem Hinweis, dass das Uhrwerk-Universum eines KEPLER und eines NEWTON inzwischen durch ein Universum abgelöst sei, in dem Relativitätstheorie, Quantenmechanik und Chaostheorie herrschten. Und in diesem physischen Kosmos gäbe es Geschehenszusammenhänge, die der Willensfreiheit strukturell äquivalent seien. [206]
Schaut man näher hin, so regen sich aber Zweifel an den unterstellten Äquivalenzen (vgl. z.B. GREEN, 2004, S.191). Die Chaostheorie etwa besagt, dass beispielsweise die Bewegungsbahn eines Teilchens der Sahne, die in eine Tasse Tee gegossen wurde, zwar den klassischen Bewegungsgesetzen unterliegt, doch ist das physische System so komplex, dass eine zukünftige Position des Teilchens bewegungsmechanisch nicht genau bestimmt werden kann. Hier taucht dann oft der Begriff des Zufalls auf, und zwar eines Zufalls in dem System (nicht von außen). Es sind dies minimale Veränderungen von Bedingungen, die nicht genau vorausberechnet werden können. Die Chaostheorie ist eine Theorie, die es gestatten soll, in solchen chaotischen Systemen, Wahrscheinlichkeiten vorhersagen zu können. Sie sucht nach einer Ordnung im Chaos. Es ist wohl evident, dass solche "Zufälle" kaum "kausalen Nullpunkten" strukturell äquivalent sind. [207]
Viel entscheidender ist aber bei der Beurteilung solcher Äquivalenzrecherchen, dass die Willensfreiheit im phänomenalen Lebensvollzug nichts von einem kausalen Nullpunkt an sich hat, im Gegenteil – ich sprach darüber. [208]
Ich habe dieses Fehl-Beispiel etwas näher beleuchtet, weil sich mit ihm zweierlei knapp demonstrieren lässt. Erstens, es wird klar, was mit der Suche nach Strukturparallelitäten gemeint ist. Zweites, es wird klar, wofür man sorgen muss, damit sinnvolle strukturvergleichende Fragen zustande kommen: Es bedarf einer detaillierten Analyse und Erfassung der strukturell zu vergleichenden Größen, hier vor allem der phänomenanalytischen Charakteristik der erlebend-gelebten Willensfreiheit. [209]
|
Ergänzung Eine besondere Form der Rede über Strukturparallelitäten ist die Rede von "äquivalenten funktionalen Rollen", die bestimmte Einheiten in Systemen, die unterschiedlichen Gegenstandsmodi zugehören, spielen können. So kann man beispielsweise (vgl. METZINGER & GALLESE, 2003) eine optische Täuschung entweder in ein semantisches, handlungsbezügliches System funktional einbetten (z.B. als Fehlwahrnehmung, die zu Fehlhandlungen führen kann) oder man kann die optische Täuschung als Erregung bestimmter Nervenverbände in ein physisches, neuronal-physiologisches System einbetten, um dann dort eine Funktion zu identifizieren. Strukturparallelität läge dann vor, wenn beide Funktionen in ihren Systemen funktional äquivalente Rollen spielten. Dies zu leisten, setzt voraus, dass man eine formale Systemsprache entwickelt, die dafür taugt, sowohl physische wie auch semantische (und vielleicht auch phänomenale) Zusammenhänge als Systeme auszuweisen, in denen Einheiten so parallelisierbar sind, das es sinnvoll ist, davon zu sprechen, sie spielten funktional äquivalente Rollen. Es müsste also eine Struktursprache gefunden werden, die in der Lage ist, ein physisches System (bestehend aus Einheiten, die in den Dimensionen Raum, Zeit, Masse und Energie existieren und bedingungskausal verbunden sind) und ein semantisches System (bestehend aus Einheiten, die als Ausprägungen inhaltliche Differenzen existieren und untereinander verweisungskausal verbunden sind) funktional vergleichbar zu artikulieren und zu strukturieren. Mir ist keine formale Struktursprache bekannt, die dies leistet. Zwar wird von physischen, von psychischen und von sozialen Systemen gesprochen, so wie einst von einer physischen, einer psychischen und einer sozialen Mechanik gesprochen wurde (vgl. HERBART, 1824/25), doch bleibt offen, wie diese Redeweisen das leisten, was sie zu leisten verheißen. In diesem Sinne bezweifelte beispielsweise Martin SCHERER (vgl. HEIDER, 1984, S.150), dass der physikalische Feldbegriff dazu tauge, physische und semantische bzw. phänomenale Zusammenhänge strukturell isomorph zu erfassen. So sagen denn auch METZINGER und GALLESE (2003), dass "a more extensive functional analysis" erforderlich ist "to build a conceptual bridge between physiological and representational levels of description" (S.575), wobei ich hier offen lasse, ob es angemessen ist, von "Beschreibung" zu reden. [210] |
6. Neurosophische Gegenaufklärung: Sich selbst auf den Leim gehen!
Wer Neurowissenschaftler in öffentlichen Diskussionen erlebt, der gewinnt den Eindruck, die glauben, was sie sagen. Die sehen sich tatsächlich in einer Reihe mit KOPERNIKUS. In der Wiedergabe des schon öfter erwähnten Diskussionsforums in der Süddeutschen Zeitung zum Thema "Wie frei ist der Mensch?" wurde in der Tat ausdrücklich und unwidersprochen von einer der kopernikanischen Wende vergleichbaren neurobiologischen Wende gesprochen, und zwar im Blick auf die Willensfreiheit und ihre empirisch-wissenschaftliche Illusionierung – eben: "Vierte Kränkung der Menschheit". [211]
Ich denke, diese Kränkung lässt sich gut verschmerzen, wenn man sich klar macht, wie sie zustande kommt:
Man bestimme eine Größe, genannt Willensfreiheit oder "Gefühl, etwas frei zu wollen".
Man nehme einen Realitätsentwurf, den physischen, der so geartet ist, dass aus ihm Größen wie Willensfreiheit oder "Gefühl, etwas frei zu wollen" definitorisch ausgeschlossen sind. – In einem Interview stellt kürzlich eben dies der theoretische Physiker Brian GREEN (2004) fest: "Deshalb ist ja auch der freie Wille (für die Physiker; U.L.) ein so problematisches Phänomen: Im Grunde lässt die Physik dafür keinen Platz" (S.191).
Man behaupte, dass der Realitätsentwurf der physischen Denkform der einzige ist, der wissenschaftlich zulässig sei. Es gibt nur das, was in ihm gegenständlich einen Platz einnehmen kann. – Zum Beispiel: "The world is composed exclusively of concrete (material) things that behave lawfully" (BUNGE, 1991, S.135; m. Hervorh.).
Man folgere dann durchaus schlüssig, dass es Willensfreiheit oder "Gefühl, etwas frei zu wollen" nicht gibt. – Tautologische Aussagen haben es an sich, die in sich schlüssigsten zu sein.
All diese apriorisch richtigen Zusammenhänge inszeniere man sodann irgendwie experimentell, um ihnen einen empirischen Anstrich zu geben, wobei von vornherein klar ist, was auch immer heraus kommt, die existenzbezügliche Hypothese der Neurowissenschaftler wird bestätigt werden: Es gibt keine Willensfreiheit! – Das ist ein Paradefall von Pseudoempirie. [212]
Manchmal jedoch habe ich den hoffnungsfrohen Eindruck, dass auch dem einen oder anderen der Neurowissenschaftler, die als Illusionsentlarver durch die Lande ziehen, zumindest dämmert, wie er argumentiert. So antwortet etwa ROTH auf die Frage eines Zuhörers im SZ-Forum, ob man für die neurowissenschaftliche Einsicht, dass es die Willensfreiheit nicht gibt, wirklich erst empirische Hirnforschung betreiben müsse: "Ein guter Menschenkenner konnte das seit zweieinhalbtausend Jahren wissen" (zit. n. Süddeutsche Zeitung, 2004, Nr. 113, S.12). Ich denke, man braucht kein guter Menschenkenner zu sein, man muss bloß darauf achten, was man gegenständlich a priori gesetzt hat, um zu erkennen, dass in diesen ontischen Setzungen für die Willensfreiheit kein gegenständlicher Platz ist. Deutet man diese Setzung allerdings empirisch aus, dann geht man seinen eigenen gegenständlichen Prämissen auf den Leim. [213]
|
Ergänzung Dazu, sich der Prämissen eigenen Denkens klar zu sein, gehört auch, dass ich diese Arbeit damit abschließe, festzustellen, dass sich aus ihr weder die Existenz noch die Inexistenz der Willensfreiheit, welcher Variante auch immer, ableiten lässt. Thema der Arbeit war lediglich, darzulegen, in welchen Denkformen und ihren Gegenstandsentwürfen sich das, was als Willensfreiheit expliziert worden ist, gegenständlich verorten lässt. Die phänomenale Denkform liefert demnach einen Gegenstandsentwurf, in dem sich die Willensfreiheit in der explizierten Fassung problemlos unterbringen lässt. Was sich deutlich wohl auch darin zeigt, dass es die phänomenologisch angelegte Existenzphilosophie ist, in der die Freiheitsfrage am intensivsten erörtert worden ist. Und die vorliegende Arbeit soll ferner zeigen, dass der dabei postulierte phänomenale Kosmos kein flüchtiges und wissenschaftlich ungreifbares Gebilde ist. Er ist äußerst handfest und gegenständlich erforschbar. [214] |
Baldwin, Alfred L. (1967). Kurt Lewin and field theory. In Alfred L. Baldwin, Theories of child development (S.85-166). New York: Wiley.
Barkin, Edward (2003). Relative phenomenalism. Toward a more plausible theory of mind. Journal of Consciousness Studies, 10, 3-13.
Beaulieu, Anne (2003). Brains, maps and the new territory of psychology. Theory & Psychology, 13, 561-568.
Bolender, John (2001). An argument for idealism. Journal of Consciousness Studies, 8, 37-61.
Boucsein, Wolfram (1999). Electrodermal activity as an indicator of emotional processes. Korean Journal of the Science of Emotion & Sensibility, 2, 1-25.
Braddock, Glenn (2001). Beyond reflections in naturalized phenomenology. Journal of Consciousness Studies, 11, 3-16.
Bürgy, Martin (2003). Zur Phänomenologie der Verzweiflung bei der Schizophrenie. Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie, 51, 1-16.
Bunge, Mario (1991). A skeptic's beliefs and disbeliefs. New Ideas in Psychology, 9, 131-149.
Buytendijk, Frederik J.J. (1967) The phenomenological approach to the problem of feeling and emotion. In Theodore Millon (Hrsg.), Theory of psychopathology (S.254-261). Philadelphia: Saunders.
Cacioppo, John T.; Semin, Gün & Berntson, Gary G. (2004). Realism, intrumentalism, and scientific symbiosis. Psychological theory as a search for truth and the discovery of solutions. American Psychologist, 59, 214-223.
Carpenter, Roger H.S. (1996). Neurophysiology (3. Aufl.). London: Arnold.
Cassirer, Ernst (1980). Zur Logik der Kulturwissenschaften (4. Aufl., erstmals 1942). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Cassirer, Ernst (1996). Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur. Hamburg: Meiner. (Dt. Übers., Orig. 1942)
Chalmers, David (1996). The conscious mind. New York: Oxford University Press.
Churchland, Paul S. (1988). Matter and consciousness: A contemporary introduction to the philosophy of mind. Cambridge: University of Cambridge Press.
Claus, Volker (1986). Stichwort Information. In Schülerduden: Die Informatik (S.242). Mannheim: Bibliographisches Institut.
Cotterill, Rodney M.J. (2001). Evolution, cognition and consciousness. Journal of Consciousness Studies, 8, 3-17.
Crick, Francis H. (1997). Was die Seele wirklich ist. Die naturwissenschaftliche Erforschung des Bewusstseins. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt. (Dt. Übers., Orig. 1994)
Damasio, Antonio R. (1995). Descartes' Irrtum: Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. München: Fink. (Dt. Übers.)
Dance, John (2000). Phenomenology and consciousness. A review article. Journal of Consciousness Studies, 7, 69-74.
Danner, Manfred (1968). Warum es keinen freien Willen gibt. Hamburg: Kriminalistik Verlag.
Dörner, Dietrich (1999). Bauplan der Seele. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt.
Eddington, Arthur S. (1928). The nature of the physical world. Cambridge: Cambridge University Press.
Elger, Christian E.; Friederici, Angela D.; Koch, Christof; Luhmann, Heiko; von der Malsburg, Christoph; Menzel, Randolf; Monyer, Hannah; Rösler, Frank; Roth, Gerhard; Scheich, Henning & Singer, Wolf (2004). Das Manifest. Elf führende Neurowissenschaftler über Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung. Gehirn & Geist, 6, 30-37.
Epstein, Russell (2000). The neural-cognitive basis of the Jamesian stream of consciousness. Consciousness and Cognition, 9, 550-575.
Feinberg, Todd E. (2001). Why the mind is not a radically emergent feature of the brain. Journal of Conscious Studies, 8, 123-145.
Fernandez, Guillen & Weber, Bernd (2003). Fischefangen im Erinnerungsnetz. Gehirn & Geist, 2, 68-73.
Flohr, Hans (1996). Ignorabimus? In Gerhard Roth & Wolfgang Prinz (Hrsg.), Kopf-Arbeit: Gehirnfunktionen und kognitive Leistungen (S.435-450). Heidelberg: Spektrum-Verlag.
Foucault, Michel (2003). Dits et ecrits. Schriften, Bd. 3: 1972-1976. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Freud, Sigmund (1964). Gesammelte Werke, Bd. 15 (2. Aufl.). Frankfurt a.M.: Fischer.
Fuster, Joaquin M. (1989). The prefrontal cortex: Anatomy, physiology, and neuropsychology of the frontal lobe (2. Aufl.). New York: Raven Press.
Georgieff, Nicolas & Jeannerod, Marc (1998). Beyond consciousness of external reality: A "Who" system for consciousness of action and self-consciousness. Consciousness and Cognition, 7, 465-477.
Gergen, Kenneth J. (2002). Konstruierte Wirklichkeiten. Stuttgart: Kohlhammer. (Dt. Übers.)
Gerrans, Philip (2003). The motor of cognition. Consciousness and cognition, 12, 510-512.
Gibson, James J. (1979). The ecological approach to visual perception. Boston: Houghton Mifflin.
Green, Brian (2004). Warum ist nicht nichts? Spiegel-Interview. Der Spiegel, 39/20. 9. 04, S.191-194.
Greve, Werner (1994). Handlungserklärung. Die psychologische Erklärung menschlichen Handelns. Bern: Huber.
Gruber, Howard E. & Barrett, Peter H. (1974). Darwin on man. A psychological study of human creativity. London: Wildwood.
Gurwitsch, Aaron (1975). Das Bewusstseinsfeld. Berlin: de Gruyter. (Dt. Übers.)
Hacker, Winfried (1978). Allgemeine Arbeits- und Ingenieurpsychologie. Bern: Huber.
Hadot, Pierre (1991). Philosophie als Lebensform. Geistesübungen in der Antike. Berlin: Gatzka.
Haeckel, Ernst (ca. 1860). Methodik der Morphologie der Organismen. Kritik der naturwissenschaftlichen Methoden, welche sich gegenseitig nothwendig ergänzen müssen.
Haggard, Patrick & Libet, Benjamin (2001). Conscious intention and brain activity. Journal of Consciousness Studies, 8, 47-63.
Hartmann, Dirk (2000). Willensfreiheit und die Autonomie der Kulturwissenschaften. Handlung Kultur Interpretation, 9, 66-103.
Hartmann, Nicolai (1962). Ethik (4. Aufl.). Berlin: de Gruyter.
Heider, Fritz (1984). Das Leben eines Psychologen. Eine Autobiographie. Bern: Huber. (Dt. Übers.)
Hensel, Herbert (1962). Sinneswahrnehmung und Naturwissenschaft. Studium Generale, 15, 747-758.
Herbart, Johann Friedrich (1824/25) Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik, 2 Bde. Königsberg: Unger.
Herrmann, Theo (1987). Die nomologische Theorie und das intentionale Denkmuster. In Wolfgang Maiers & Morus Markard (Hrsg.), Kritische Theorie als Subjektwissenschaft (S.106-119). Frankfurt a.M.: Campus.
Herrmann, Theo (1988). Mentale Repräsentation – ein erklärungsbedürftiger Begriff. Sprache & Kognition, 7, 162-175.
Horgan, John (1999). The undiscovered mind. New York: Free Press.
Hume, David (1955). A treatise of human nature. Indianapolis: Bobbs-Merrill. (Orig. 1739)
Humphrey, Nicholas (2000). How to solve the mind-body problem. Journal of Consciousness Studies, 7, 5-20.
Husserl, Edmund (1954). Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie. Husserliana Bd. 6 (hrsg. v. Walter Diemel). Den Haag: Nijhoff.
Jeannerod, Marc (1997). The cognitive neuroscience of action. Oxford: Blackwell.
Kaminski, Gerhard (1970). Verhaltenstheorie und Verhaltensmodifikation. Stuttgart: Klett.
Kant, Imanuel (1967). Kritik der reinen Vernunft. Hamburg: Meiner. (Orig. 1787)
Keen, Ernest (1986). Paranoia and cataclymic narratives. In Theodore R. Sarbin (Hrsg.), Narrative psychology. The storied nature of human conduct (S.174-190). New York: Praeger.
Kim, Jaengwon (1992). Downward causation in emergentism and nonreductive physicalism. In Ansgar Beckermann, Hans Flohr & Jaengwon Kim (Hrsg.), Emergence or reduction? Essay on the prospects of nonreductive physicalism (S.119-138). New York: de Gruyter.
Kim, Jaengwon (1998). Mind in a physical world: An essay on the mind-body problem and mental causation. Cambridge: MIT-Press.
Kincaid, Harold (1990). Defending laws in the social sciences. Philosophy of the Social Sciences, 20, 56-83.
Köhler, Wolfgang (1960). The mind-body problem. In Sidney Hook (Hrsg.), Dimensions of mind: A symposium (S.3-23). New York: New York University Press.
Kuiken, Don; Schopflocher, Don & Wild, T. Cameron (1989). Numerically aided methods in phenomenology: A demonstration. Journal of Mind and Behavior, 10, 373-392.
Laucken, Uwe (1994). Psyche und Subjekt im Denken antiker Philosophen. Heilende Selbstbehandlung und lebensweltliches Sein. In Hans-Wolfgang Hoefert & Christoph Kotter (Hrsg.), Neue Wege der Psychologie (S.231-297). Heidelberg: Asanger.
Laucken, Uwe (2001). Qualitätskriterien als wissenschaftliche Lenkinstrumente [83 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 3(1), Art. 6. Verfügbar über: http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-02/1-02laucken-d.htm.
Laucken, Uwe (2003a). Theoretische Psychologie. Denkformen und Sozialpraxen. Oldenburg: BIS-Verlag der Universität Oldenburg.
Laucken, Uwe (2003b). Über die semantische Blindheit einer neurowissenschaftlichen Psychologie. Oder: Was hätte uns eine so gewendete Psychologie zum "Dialog der Kulturen" zu sagen? Journal für Psychologie, 11, 149-175.
Laucken, Uwe (2004). Individuum und Sozialstruktur. Eine problematische Beziehung und eine Möglichkeit, diese zu fassen. In Gerd Jüttemann (Hrsg.), Psychologie als Humanwissenschaft. Ein Handbuch (S.165-180). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Lenk, Hans (2001). Kleine Philosophie des Gehirns. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Lewin, Kurt (1935). Dynamic theory of personality. New York: McGraw-Hill.
Libet, Benjamin (1985). Unconscious cerebral initiative and the role of unconscious will on voluntary action. Behavioral and Brain Sciences, 8, 529-567.
Libet, Benjamin (1999). Do we have free will? Journal of Consciousness Studies, 6, 47-57.
Libet, Benjamin (2002). The timing of mental events: Libet's experimental findings and their implications. Consciousness and Cognition, 11, 291-299.
Libet, Benjamin; Gleason, Curtis A.; Wright, Elwood W. & Pearl, Dennis K. (1983). Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness potential): The unconscious initiation of a freely voluntary act. Brain, 102, 623-642.
Lindsay, Peter H. & Norman, Donald A. (1973). Human information processing (4. Aufl.). London: Academic Press.
Lorenz, Konrad (1968). Haben Tiere ein subjektives Erleben? Zürich: Arche Nova.
Lübbe, Hermann (1972). Bewusstsein in Geschichten. Freiburg: Rombach.
MacKay, Donald M. (1966). Cerebral organization and the conscious control of action. In John C. Eccles (Hrsg.), Brain and conscious experience (S.422-455). New York: Springer.
Markowitsch, Hans J. (2001). Neuropsychologie des menschlichen Gedächtnisses. Spektrum der Wissenschaft, 2, 52-61.
Markowitsch, Hans J. (2002). Dem Gedächtnis auf der Spur. Vom Erinnern und Vergessen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
McIntosh, Anthony; Fitzpatrick, Susan & Friston, Karl (2001). On the marriage of cognition and neuroscience. Neuroimage, 14, 1231-1237.
Mead, Georg H. (1934). Mind, self and society: From the standpoint of a social behaviorist (hrsg. v. Charles Morris). Chicago: Chicago University Press.
Metzinger, Thomas (2003). Being no one. The self-model theory of subjectivity. Cambridge: MIT-Press.
Metzinger, Thomas & Gallese, Vittorio (2003). Of course they do. Consciousness and Cognition, 12, 574-576.
Meyer, H. (1909). Zur Psychologie der Gegenwart. In Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland, Erste Vereinsschrift (S.7-104). Köln: Bachem.
Miller, Georg A.; Galanter, Eugene & Pribram, Karl H. (1960). Plans and the structure of behavior. New York: Holt.
Montero, Barbara (2001). Post-physicalism. Journal of Consciousness Studies, 8, 61-80.
Nelson, Thomas O. (1996). Consciousness and metacognition. American Psychologist, 51, 102-116.
Newell, Alan; Shaw, J.C. & Simon, Herbert, A. (1958). Elements of a theory of human problem solving. Psychological Review, 65, 151-166.
Newton, Nikita (2001). Emergence and the uniqueness of consciousness. Journal of Consciousness Studies, 8, 47-59.
Nyberg, Lars (2001). Functional neuroimaging of cognition: State-of-the-art. Scandinavian Journal of Psychology, 42, 163-165.
Ochsner, Kevin N. & Lieberman, Matthew D. (2001). The emergence of social cognitive neuroscience. American Psychologist, 56, 717-734.
Oelze, Berthold (1988). Gustav Theodor Fechner. Seele und Beseelung. Münster: Waxmann.
Piaget, Jean (1968). Explanation in psychology and psychophysiological parallelism. In Paul Fraisse & Jean Piaget (Hrsg.), Experimental psychology its scope and method. Band I: History and method (S.153-191). London: Routledge and Kegan. (Engl. Übers., franz. Orig. 1963)
Planck, Max (1943). Wege zur physikalischen Erkenntnis. Reden und Vorträge (Bd. 1, 3. Aufl.). Leipzig: Barth.
Plessner, Helmuth (1980-83). Gesammelte Schriften, 10 Bde. (hrsg. v. Günter Dux, Odo Marquard & Elisabeth Ströker). Frankfurt a.M. : Suhrkamp.
Penrose, Roger (1991). Computerdenken. Die Debatte um Künstliche Intelligenz, Bewusstsein und die Gesetze der Physik. Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft. (Dt. Übers.)
Popper, Karl Raimund & Eccles, John C. (1982). Das Ich und sein Gehirn. München: Piper. (Dt. Übers.)
Potter, Garry (2002). For Bourdieu, against Alexander: Reality and reduction. Journal for the Theory of Social Behaviour, 30, 229-246.
Pratt, Karl C. (1939). The logic of modern psychology. New York: Macmillan.
Proust, Joelle (2003). Thinking of oneself as the same. Consciousness and cognition, 12, 495-509.
Ramsey, A.S. (1954). Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press.
Roth, Gerhard (1997). Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Roth, Gerhard (2000). Geist ohne Gehirn? Hirnforschung und das Selbstverständnis des Menschen. Forschung & Lehre, 5, 249-251.
Roth, Gerhard (2001). Ist Geist naturwissenschaftlich erklärbar? Hochschulöffentlicher Vortrag an der Universität Oldenburg am 21.11.2001.
Roth, Gerhard (2004a). Kant und die Hirnforschung. Lehre & Forschung, 3, 132-133.
Roth, Gerhard (2004b). Warum sind Lehren und Lernen so schwierig? Zeitschrift für Pädagogik, 50, 496-506.
Ryle, Gilbert (1949). The concept of mind. New York: Barnes & Noble.
Sanders, James C.; McClure, Kimberley A. & Zárate, Michael A. (2004). Cerebral hemispheric asymmeties in social perception: Perceiving and responding to the individual and the group. Social Cognition, 22, 279-291.
Sartre, Jean Paul (1943). L'être et le néant. Paris: Gallimard.
Schäffle, Albert E. F. (1875-78). Bau und Leben des sozialen Körpers, 4 Bde. Tübingen: Laupp'sche Buchhandlung.
Schapp, Wilhelm (1959). Philosophie der Geschichten. Leer. Rautenberg.
Schapp, Wilhelm (1976). In Geschichten verstrickt. Zum Sein von Mensch und Ding (2. Aufl.; Orig. 1953). Wiesbaden: Heymann.
Schnädelbach, Herbert (2004). Drei Gehirne und die Willensfreiheit. Pseudoerklärungen im Gewand der Wissenschaft: Die neu aufgewärmte immergleiche Geschichte in neurophilosophischer Variante. Frankfurter Rundschau, 25.5.2004: Forum Humanwissenschaft.
Schrödinger, Erwin (1989). Geist und Materie. Zürich: Diogenes. (Dt. Übers., Orig. 1942)
Searle, John R. (1984). Minds, brains and behaviour. Cambridge: Havard University Press.
Searle, John R. (1992). The rediscovery of the mind. Cambridge: MIT-Press, Bradford Books.
Searle, John R. (2000). Consciousness, free action and the brain. Journal of Consciousness Studies, 7, 3-22.
Singer, Wolf (1998). Consciousness and the structure of neural representation. Philosophical Transactions of the Royal Society of London (B), 353, 1829-1840.
Singer, Wolf (2000). Wer deutet die Welt? Streitgespräch zwischen Wolf Singer und Lutz Wingert. Die Zeit, 50, 7.12.2000, S.43-44.
Singer, Wolf (2003). Gehirn und Geist. Kosmos im Kopf. Vortrag, auszugsweise gesendet im Deutschlandfunk am 9.2.2003 (von 17.05 bis 17.30 Uhr).
Skinner, Burrhus F. (1971). Beyond freedom and dignity. New York: Knopf.
Smedslund, Jan (1988). Psycho-Logic. Berlin: Springer.
Sokolowski, Robert (2000). Introduction to phenomenology. Cambridge: Cambridge University Press.
Sperry, Roger W. (1987). Structure and significance of the conscious revolution. Journal of Mind and Behavior, 8, 37-66.
Tellenbach, Hubertus (1961). Melancholie. Berlin: Springer.
Vanderwolf, Case H. (1998). Brain, behavior, and mind: what do we know and what can we know? Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 22, 125-142.
Vanderwolf, Case H. (2003). A reply to Mos. Theory & Psychology, 13, 273.
Varela, Francisco (1996). Neurophenomenology: a methodological remedy for the Hard Problem. Journal of Consciousness, 3, 330-349.
Vine, Ian (1983). Sociobiology and social psychology – Rivalry or symbiosis? The explanation of altruism. British Journal of Social Psychology, 22, 1-11.
Wälde, Martin (1985). Husserl und Schapp. Von der Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins zur Philosophie der Geschichten. Basel: Schwabe.
Walde, Bettina (2003). "Ein Fingerschnipsen ist keine Partnerwahl". Interview in Gehirn & Geist, 2, 14-15.
Walter, Hendrik (1998). Neurophilosophie der Willensfreiheit. Paderborn: Schöningh.
Wasserman, Philip D. (1989). Neural computing. Theory and practice. New York: van Norstrand Reinhold.
Wegner, Daniel M. (2002). The illusion of conscious will. New York: Bradford.
Wegner, Daniel M. & Erskine, James A.K. (2003). Voluntary involuntariness: Thought suppression and the regulation of the experience of will. Consciousness and Cognition, 12, 684-694.
Wittgenstein, Ludwig (1958). The blue and brown books. London: Blackwell.
Zhu, Jing (2004). Locating volition. Consciousness and Cognition, 13, 302-322.
Uwe LAUCKEN ist Professor für Sozialpsychologie an der Universität Oldenburg. Seine Forschungsgebiete lassen sich in folgende Rubriken unterteilen: 1. Umgangswissen – seine logographische Explikation und seine sozialpraktische Bedeutung (vgl. z.B. zus. m. Ulrich MEES "Logographie alltäglichen Lebens. Leid, Schuld und Recht in Beschwerdebriefen über Lärm". Oldenburg: Holzberg, 1987). 2. Theoretische Psychologie (vgl. z.B. "Theoretische Psychologie. Denkformen und Sozialpraxen". Oldenburg: BIS-Verlag der Universität Oldenburg, 2003). 3. Geschichte der Psychologie (vgl. z.B. "Sozialpsychologie. Geschichte, Hauptströmungen, Tendenzen". Oldenburg: BIS-Verlag der Universität Oldenburg, 1998). 4. Individual- und Sozialsemantik zwischenmenschlicher Beziehungen (vgl. z.B. "Zwischenmenschliches Vertrauen". Oldenburg: BIS-Verlag der Universität Oldenburg, 2001).
Kontakt:
Prof. Dr. Uwe Laucken
Universität Oldenburg
Institut für Psychologie
Abt. Umwelt & Kultur
Postfach 2503
D-26111 Oldenburg
E-Mail: uwe@laucken.de
URL: http://www.uwe-laucken.de/
Laucken, Uwe (2004). "Gibt es Willensfreiheit?" Möglichkeiten der psychologischen Vergegenständlichung von "Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit" [214 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 6(1), Art. 8, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs050185.
Revised 6/2008